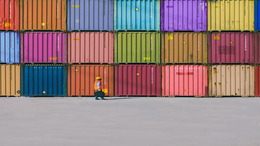Sonja Miekley / AHK Tunesien
Tunesien: Von Reformen in Osteuropa lernen
Tunesien verhandelt mit Brüssel über mehr Integration. Die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau sehen in der engeren wirtschaftlichen und rechtlichen Verflechtung mit der EU die Chance, Strukturreformen bei sich voranzubringen. Der direkte Austausch gab Einblick in unterschiedliche Wege der Ausgestaltung.
Tunesien verhandelt seit 2015 mit Brüssel über eine intensivere wirtschaftliche Integration. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind hin- und hergerissen. Die einen sehen vor allem die Chancen, etwa Modernisierung und Dynamik für die Wirtschaft, neue Arbeitsplätze sowie bessere und preiswertere Produkte für die Konsumenten. Andere fürchten, dass tunesische Unternehmen unter mehr Marktöffnung oder wegen regulatorischer Anforderungen leiden werden.
Die Ukraine, Georgien und die Republik Moldawien haben seit rund zwei bzw. vier Jahren „tiefe und umfassende Freihandelszonen“ mit der EU auf der Basis sogenannter DCFTAs, englisch für Deep and Comprehensive Free Trade Agreements. Der französische Fachjargon spricht von ALECA, Accord de Libre Échange Complet et Approfondi.
Auf Anfrage tunesischer Stakeholder stellte das Europa Programm der Bertelsmann-Stiftung eine Delegation aus ehemaligen Verhandlern und unabhängigen Experten aus den "DCFTA3" genannten Ländern Ukraine, Georgien und Moldau zusammen. Die Praktiker und Think-Tank-Vertreter teilten ihre Erfahrungen und Beobachtungen in Arbeitssitzungen mit Repräsentanten aus der Regierung und Vertretern der unterschiedlichen Verhandlungsteams, an Runden Tischen mit der Zivilgesellschaft und zentralen Verbänden, etwa der Freien Berufe, der Arbeitgeber und der Gewerkschaften, sowie in öffentlichen Veranstaltungen. Der Austausch ging über die Hauptstadt Tunis hinaus bis in die südliche Provinzstadt Sfax – ein wichtiges Signal in Tunesien, wo sich die Regionen nicht selten gegenüber der Hauptstadt sozial und wirtschaftlich benachteiligt fühlen.
Inflation, Preise und Staatsschulden steigen in Tunesien, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch - sehr vielen ist bewusst, dass Land und Gesellschaft sich reformieren müssen, wirtschaftlich und sozial. Dank der mit der Revolution 2011 eingezogenen gesellschaftlichen Öffnung diskutiert das ganze Land das Für und Wider von Reformen und die Beziehungen zu Europa, vom Parlament über die Medien bis in die Zivilgesellschaft.
Was ist der richtige Weg zu mehr Wohlstand für alle Tunesier?
Die Strategie der EU: Gesellschaftliche Öffnung und Modernisierung in den Ländern der EU-Nachbarschaft als Basis für Wohlstand, was wiederum Stabilität und Sicherheit auch für Europa bedeutet. Denn die wirtschaftliche Integration in den EU-Binnenmarkt bricht mit verkrusteten Wirtschaftsstrukturen und bietet den Ländern Chancen auf Investitionen, mehr Produktivität und Arbeitsplätze.
Die östlichen Nachbarn Georgien, Moldau und die Ukraine hat diese Strategie überzeugt – trotz bzw. gerade wegen ihrer schwierigen politischen und wirtschaftlichen Ausgangslage. Die frei gewählten Regierungen dieser Länder sehen in mehr Integration mit der EU vor allem die Chance, ihre Länder umfassend zu modernisieren und sich von Russland zu emanzipieren. Ihre ersten Erfahrungen: Um international bestehen zu können, haben sie viel aufzuholen. Einige Firmen erwiesen sich als nicht überlebensfähig, Arbeitsplätze gingen verloren. Gleichzeitig zeigte sich, dass andere Wirtschaftszweige profitieren, neue Arbeitsplätze entstehen. Nicht nur die Handelsbilanz mit der EU entwickelt sich positiv. Insbesondere Georgien nutzt seine geographische Lage und damit verbundene Herausforderungen, um etwa für China und Indien ein Hub in der Nähe Europas zu werden.
„Wir haben die Vertreter der EU-Kommission ständig gefragt, wie diese oder jene Formulierung im Abkommen zu verstehen ist und welche Spielräume sie zulässt – um für uns zu klären, welche Vorteile sie für uns Georgier bringen kann,“ berichtet die ehemalige georgische Verhandlungschefin Tamara Kovziridze dem tunesischen Verhandlungsteam in einer Sitzung im Premierministerium in Tunis am 26. Juni.
Adrian Lupusor aus Moldau: „Jede Reform hat ihre Gewinner und ihre Verlierer. Es gilt, die potentiellen Verlierer zu identifizieren und ihre Kosten zu minimieren. Aber es muss unterschieden werden zwischen denen, die aufgrund struktureller Probleme nicht wettbewerbsfähig sind und jenen, die weiter ihre Partikularinteressen und Monopole schützen wollen.“
Was nehmen die Tunesier mit aus dem Austausch mit den Osteuropäern?
Georgien, Moldau und die Ukraine sind ganz unterschiedliche Wege gegangen, ihre jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Systeme, kulturellen und geographischen Besonderheiten berücksichtigend. Die Ukraine hatte sogar zwei Revolutionen; der Wirtschaft aller drei Länder ging es schlecht, etwa defizitären Staatsbetrieben in der Ukraine. Alle drei osteuropäischen Länder haben, so ihre Experten, keine unmittelbare EU-Beitrittsperspektive. In der engen wirtschaftlichen und rechtlichen Verflechtung mit der EU sahen die „DCFTA3“ dennoch die Chance, wesentliche Strukturreformen in ihren Ländern voranzubringen. Sie nutzten dabei gezielt die von der EU angebotenen Möglichkeiten, etwa die Marktöffnung flexibel zu gestalten und für ausgesuchte Wirtschaftszweige Übergangszeiten zu vereinbaren. Insbesondere Regeln und Standards anzugleichen kostet Zeit und Ressourcen.
Valeriy Piatnitskiy aus der Ukraine: „Wir haben uns weit weg entwickelt vom ersten Textvorschlag der EU. Am Ende von vier Verhandlungsjahren hatten wir ein ganz anderes Abkommen.“
Was sagen die Osteuropäer im Rückblick? Was hätten sie besser machen können?
Die politische Führung sollte in einem offenen und intensiven Dialog mit der Gesellschaft und der Wirtschaft zunächst eigene Visionen für das Land und die einzelnen Wirtschaftssektoren entwickeln – und auf dieser Grundlage Reformen planen und umsetzen. ALECA und andere Formen der wirtschaftlichen Integration mit der EU sind kein Ersatz für eine eigene länderspezifische Reformstrategie und Handlungspläne. Beides ist aufeinander abzustimmen. Denn der Erfolg auch des bestverhandelten Abkommens hängt letztendlich von der Implementierung ab. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung und des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsforschung von 2016: „Benefits and Costs of DCFTA“.
Die Bildung von Stakeholder-Netzwerken innerhalb der europäischen Nachbarschaft bringt auch ganz neue Ideen zu Tage: Bei dem Besuch eines tunesischen Familienbetriebes für Lebensmittelproduktion in Sfax schlägt der ehemalige ukrainische Chefverhandler Valery Piatnitskyi den Unternehmern vor: „Kauft Zucker aus der Ukraine und liefert uns Euer wunderbares Olivenöl!“
Konzipiert und organisiert wurde diese Initiative von der Osteuropa-Expertin Miriam Kosmehl und dem Nahost-Fachmann Christian Hanelt von der Bertelsmann Stiftung sowie der Tunesisch-Deutschen Industrie und Handelskammer in Tunis.