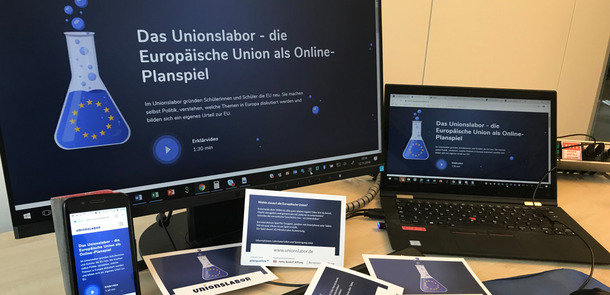Spitzenkandidaten um das Amt des Kommissionspräsidenten, Euroskeptiker und EU-Gegner: Diese Europawahl war anders als alle Wahlen seit 1979, als das Europäische Parlament erstmals direkt gewählt wurde. Ein Kommentar von Joachim Fritz-Vannahme zum Wahlausgang.
Diese Europawahl war anders als alle Wahlen seit 1979, als das Europäische Parlament erstmals direkt gewählt wurde. Anders, weil es für die großen Parteienfamilien wie die Sozialisten, die Europäische Volkspartei oder die Liberalen jeweils einen Spitzenkandidaten gab, der Anspruch auf den Sitz des Kommissionspräsidenten erhob. Wahlsieger: Jean-Claude Juncker, der polyglotte, langjährige christdemokratische Regierungschef Luxemburgs. Kaum vorstellbar, dass sich die Staats- und Regierungschefs über das Votum und seinen Wahlerfolg hinwegsetzen und einen anderen küren. Juncker hat sich im intensiven Wahlkampf quer durch die Union mit Martin Schulz, dem Spitzenkandidaten der Sozialistischen Parteien, dem Publikum in zig Debatten gestellt, er wird ihn im künftigen Europäischen Parlament als Mitstreiter einer Großen Koalition der Vernunft wiedersehen.
Der erste Versuch mit Spitzenkandidaten hat sich gelohnt. Auch wenn die meisten unter ihnen in den Positionen nicht gar so verschieden waren, so haben diese Standpunkte doch ein eindeutiges Profil, ein Gesicht bekommen. Wer dann immer noch lieber der heimischen Regierung oder gleich dem ganzen politischen Establishment einen Denkzettel an der Wahlurne verpassen wollte, der konnte sich dieses Mal nicht einfach mit der Klage über das gesichtslose Europa herausreden.
Anders war diese Wahl 2014, weil im krisengepeinigten EU-Europa allenthalben die Euroskeptiker und EU-Gegner die mediale Szene beherrschten. Wer im Wahlkampf allerdings genauer hinhörte, der durfte sich wundern: Linientreu blieben allein die UKIP-Politiker im Vereinigten Königreich – sie fordern weiterhin den Austritt ihres Landes aus der EU. Marine Le Pen in Frankreich, Bernd Lucke in Deutschland, der bizarre Beppo Grillo in Italien oder auch der stramm linke Alexis Tsipras in Griechenland fordern vor allem eine andere EU – der eine will sie sozialer und antikapitalistischer, der andere liberaler und wettbewerbsstärker, die dritte schließlich ganz in den Farben Frankreichs und möglichst ohne Ausländer.
Die Mär von der Einheitsfront der Populisten
Sollten die linken und rechten Populisten irgendwie gespürt haben, dass viele Wähler zwar viel am Zustand dieser EU auszusetzen haben, aber sich nicht ausmalen wollen, wie dieses Europa ohne das zivilisierende Band der Union ausschauen würde?
Zudem löste sich die Mär von der Einheitsfront der Populisten in diesen Wochen vor aller Augen auf, wie auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung über das "Netz der Populisten" belegt. Die Alternative für Deutschland will mit Geert Wilders niederländischer Partei für die Freiheit nichts zu tun haben, Nigel Farages UKIP verweigert Le Pen und ihrem Front National den Handschlag und Tsipras linksradikale Syriza trennen von der rechtsradikalen Jobbik in Ungarn gleich ganze Welten.
Geeint sind vielmehr die Pro-Europäer von Mitte-Rechts bis Mitte-Links, im erklärten Willen, dass die richtige Antwort auf die europäische Krise nur ein besseres, stärkeres Europa sein kann. Aber wie? Nun, das wird man in den kommenden Monaten sehen und ablesen können an der Besetzung und Struktur der EU-Kommission, an der Personalwahl für den EU-Außenminister, pardon, den "Hohen Vertreter" für auswärtige Angelegenheiten, aber auch an den Akzenten, die das neue Europäische Parlament setzen wird. Hier ist nicht nur der Wähler in der Verantwortung, der ja jetzt sein Votum abgegeben hat. Verantwortlich sind auch die Regierungen der Mitgliedsstaaten und die nationalen Parlamente, die über das Personal der wichtigsten EU-Institutionen mitentscheiden. Ob das in den Hauptstädten schon allen bewusst ist?
Wahlbeteiligung stabil auf niedrigem Niveau
Anders war diese Wahl nicht bei der Wahlbeteiligung, die europaweit mit durchschnittlich 43 Prozent kaum besser ausfiel als vor fünf Jahren. Doch auch hier lohnt ein zweiter Blick. Diese EU sei ja leider so weit weg vom Bürger, so komplex und mitunter unbegreiflich, wird gerne geklagt. Nur, wie will man dann die niedrige Wahlbeteiligung auch in jenen Ländern erklären, wo die Europawahl mit Kommunalwahlen gekoppelt war?
Die EU-Wahlen seien ja nicht so wichtig wie nationale Voten, die über Regierung und Opposition entscheiden, so lautet ein anderes, beliebtes Argument, um den Urnengang zu verweigern. Ganz falsch ist das nicht, darum aber noch lange nicht richtig: Denn in der Europäischen Union entscheiden in fast allen Politikfeldern inzwischen gemeinsam das Europäische Parlament und der Europäische Rat der Regierungschefs. Woraus umgekehrt folgt: So mächtig wie einst ist die eigene Regierung schon längst nicht mehr.
Und wenn die niedrige Wahlbeteiligung, die eine Konstante europäischer Politik geworden ist, im Grunde weder verwerflich noch besorgniserregend wäre? Demokratisch legitimiert ist diese EU ja auf jeden Fall, durch die nationalen Parlamente und Regierungen, die Integrationsverantwortung tragen, als auch durch ein Europäisches Parlament, an dem vorbei künftig kein Kommissionspräsident, ja überhaupt kein Kommissar mehr gekürt werden kann. Denn auch die designierten Kommissare erwartet im Herbst eine stundenlange, penible Anhörung vor dem Europäischen Parlament. Und es gab schon Fälle, wo nach dem Hearing der Kandidat das Handtuch werfen musste. "Undemokratisch“ sieht anders aus.
Alles bestens in Europa?
Alles bestens in Europa also? Nein, das nun wahrlich nicht. Dänische Volkspartei, britische UKIP, französische Front National sind in ihren Ländern die Wahlsieger und verändern somit grundstürzend die dortige politische Landschaft. Auch andernorts verfing die Parole von den geschlossenen Grenzen und den auszugrenzenden Ausländern auf bestürzende Weise. Die Angst und die Wut wählten also mit: Die Angst vor den Ausländern und um den eigenen Arbeitsplatz; und die Wut auf "die da oben", die angeblich so viele Menschen in Europa ungeschützt einem verschärften Wettbewerb aussetzen. Das ist jedenfalls das Gefühl, das in krisengeschüttelten Mitgliedsstaaten statistisch leicht zu untermauern ist. So klingt die Kernbotschaft dieser Europawahlen in dieser Stunde der Extreme. Auch darum waren diese Wahlen anders.
Joachim Fritz-Vannahme ist Direktor des Programms "Europas Zukunft" der Bertelsmann Stiftung.