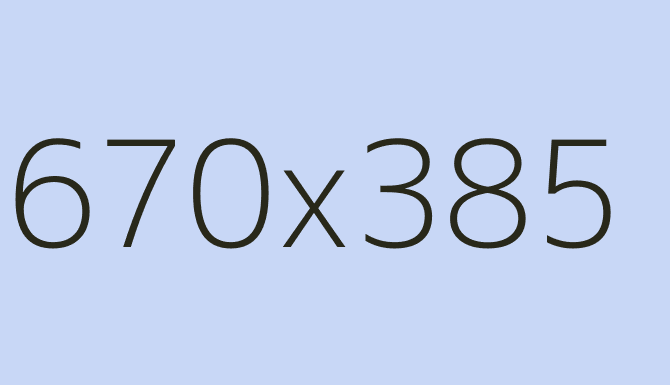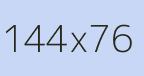Die Euro-Krise ist vorbei, zumindest offiziell: Letzten Monat haben das Europäische Parlament und der Ministerrat ein ganzes Maßnahmenpaket zur Absicherung der gemeinsamen Währung beschlossen, die sogenannte Bankenunion. Das ist tatsächlich ein großer Schritt nach vorn.
Geeinigt hat man sich auf eine Vielzahl technischer Regelungen: wie viel Eigenkapital Banken nachweisen müssen, wann eine Sanierung oder Abwicklung einzelner Institute möglich ist, wie Sparguthaben geschützt werden müssen und dass Banken unter eine europäische Aufsichtsbehörde gestellt werden.
Was technisch anmutet, ist der Versuch, eine lange Kette von gegenseitigen Abhängigkeiten zu durchtrennen: Zwischen Bankschulden und Staatschulden, zwischen Banken und nationalen Regierungen, zwischen Finanzakteuren, die aus Staatsräson nicht Bankrott gehen dürfen und Politikern, die sich erpressbar fühlen. Mit der Bankenunion liegt nun ab Herbst mehr Macht in Frankfurt – aber nicht in den Zwillingstürmen, sondern im Hochhaus der Europäischen Zentralbank.
Soweit, so gut? Nicht so voreilig. Um unsere gemeinsame Währung vor kommenden Krisen zu schützen, sei nicht eine, sondern seien vier große Aufgaben zu bewältigen. Das war zumindest das heute etwas in Vergessenheit geratene Ergebnis der Arbeitsgruppe um EU-Ratspräsident Herman van Rompuy Ende 2012. Neben der vertieften Integration der europäischen Finanzmärkte, die jetzt Gestalt angenommen hat, braucht es demnach ebenso Fortschritte in der Haushaltspolitik, der wirtschaftspolitischen Koordinierung und der demokratischen Kontrolle.
Die Diskussionen um eine mögliche Übernahme künftiger Schulden sind damit also noch nicht vom Tisch. Ebenso wenig wie die Suche nach Lösungen, um große Wachstumsunterschiede auszugleichen, wie etwa ein Sonderhaushalt der Euro-Länder. Geklärt ist schließlich auch nicht die Frage, wie nationale Parlamente wie der Bundestag oder das Europäische Parlament stärker in Entscheidungen über den Euro eingebunden werden können. Diese Hausaufgaben werden die Währungshüter auch nach den Wahlen beschäftigen.
Bei den anstehenden Wahlen wird aber nicht nur über weitere Lösungen abgestimmt. Abgestimmt wird auch darüber, wer für die Krise zur Verantwortung gezogen werden sollte. Die Parteien sind sich darin durchaus uneins. Für die europäischen Linksparteien ist die Eurokrise nicht einfach die Folge südeuropäischer Misswirtschaft, sondern der Exzesse globalisierten Kapitals. Ähnlich sehen es Europäische Grüne und Sozialdemokraten. Eine zu nachsichtige Regulierung der Finanzmärkte habe die globale Finanzkrise ausgelöst und die anschließenden zu harten Sparmaßnahmen hätten die Folgen für die Eurostaaten noch verschärft. Die Europäischen Konservativen werfen dagegen stärker einzelnen Mitgliedstaaten mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und hohe Privatverschuldung vor.
Die Währungsunion hat ihre bislang größte Krise, so scheint es, überwunden. Die Kluft zwischen Schuldnern und Gläubigern ist es noch nicht.