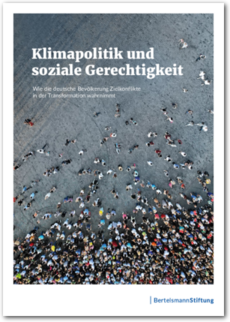Der Grundgedanke einer ambitionierten und gesellschaftlich breit getragenen Klimapolitik liegt darin, allen Mitgliedern der Gesellschaft die Klimaneutralität zu ermöglichen. Aus der empirischen Forschung ist bekannt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für konkrete klimapolitische Maßnahmen maßgeblich durch drei Faktoren bestimmt wird: Die wahrgenommene Wirksamkeit, die wahrgenommene Verteilungsgerechtigkeit und die wahrgenommenen oder erwarteten Auswirkungen einer Maßnahme auf das eigene Leben.

© Maryana - stock.adobe.com
Klimaschutz braucht Rückhalt – schafft die neue Bundesregierung gesellschaftliche Akzeptanz?
Klimapolitik kann nur erfolgreich sein, wenn sie gesellschaftlich getragen wird. Dafür braucht es glaubwürdige, sozial gerechte und machbare Maßnahmen für alle. Der aktuelle Klima-Akzeptanz-Check der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Klimaneutralität nimmt den klimapolitischen Arbeitsauftakt der neuen Bundesregierung aus Perspektive der gesellschaftlichen Akzeptanz unter die Lupe.
Inhalt
Die schwarz-rote Bundesregierung im Klima-Akzeptanz-Check
Der Koalitionsvertrag und die ersten Wochen im Amt machen deutlich, dass Union und SPD Lehren aus der Ampel-Politik ziehen wollen – gerade mit Blick auf die Sicherung der gesellschaftlichen Akzeptanz für Klimapolitik. Jedoch droht die klimapolitische Ambition auf der Strecke zu bleiben und die erste zaghafte Kommunikation der Regierung im Kontext von Klimaschutz ist strategisch mindestens bedenklich.
Unser neuer Policy Brief analysiert zentrale Elemente der Klimapolitik von Union und SPD im Gebäude- und Mobilitätsbereich vor dem Hintergrund der genannten Akzeptanz-Kriterien und entlang der vier wesentlichen Instrumentenarten des klimapolitischen Werkzeugkastens: Preissignale, Förderung, Infrastruktur und Ordnungsrecht.
- Die CO₂-Bepreisung bleibt für die neue Regierung ein zentrales Element der Klimapolitik. Gleichzeitig schärft die Koalition die Bedingung, dass CO2-Preise sozial ausgewogen gestaltet werden müssen, um Akzeptanz zu finden. Dieser differenzierte Blick ist ein Fortschritt. Die Risiken stark steigender CO₂-Preise werden anerkannt und Entlastungen (wie die deutliche allgemeine Strompreissenkung) sind geplant. Bei der konkreten Ausgestaltung zielgenauer Entlastungen bleibt sie aber vage. Doch diese sind unbedingt notwendig, um übermäßige Belastungen zu verhindern.
- In der Förderpolitik planen Union und SPD wichtige Impulse, etwa durch die stärkere Fokussierung auf CO2-Einsparungen bei der Fördermittelvergabe. Auch kündigen sie eine soziale Staffelung von Förderungen an. Allerdings bleiben viele Umsetzungsfragen offen, gerade bei der zielgenauen Unterstützung von Menschen mit wenig Geld. Gleichzeitig sollen Förderungen ausgebaut oder eingeführt werden, die vor allem für wohlhabende Haushalte attraktiv und zugänglich sind. Das Bild ist daher gemischt.
- Die Infrastrukturinvestitionen und die dahinterliegenden Sondervermögen sind der Lichtblick der neuen Regierungskonstellation: Die Koalition hat die Absicht und die finanziellen Möglichkeiten, starke Akzente beim Ausbau klimafreundlicher Infrastrukturen – etwa bei Bahn und ÖPNV, Ladepunkten und Wärmenetzen – zu setzen. Das kann klimafreundliche Alternativen für große Bevölkerungsteile zugänglich machen und so gesellschaftliche Akzeptanz für die Klimaneutralität steigern. Enttäuschend ist die schwarz-rote Koalition in Bezug auf die Gasnetze, weil keine Strategie für den sozial verträglichen Ausstieg erkennbar ist.
- Beim Ordnungsrecht agieren Union und SPD mutlos und kurzsichtig. Die Abschaffung bestehender Regeln und Vorgaben (insbesondere des „Heizungsgesetzes“) und die begleitende Kommunikation gefährden Planungssicherheit und kosten Vertrauen. Dabei ist das Ordnungsrecht gerade dort wichtig, wo individuelle Entscheidungen an strukturelle Grenzen stoßen, etwa bei Mietenden. Die Koalition verkennt, dass Ordnungsrecht in der Klimapolitik entgegen seines schlechten Rufs durchaus gesellschaftliche Akzeptanz sichern kann.
Insgesamt setzt die neue Bundesregierung stärker auf Ermöglichung statt auf Verteuerung und Verbote – ein Ansatz, der gesellschaftliche Akzeptanz fördern kann. Doch in Sachen Ambition und Tempo lässt die schwarz-rote Koalition deutlich Luft nach oben. Zwar bekennt sie sich zu den ambitionierten Klimazielen für 2030, 2040 und 2045 – doch es bleiben Zweifel, ob die Maßnahmen diesem Anspruch gerecht werden können. Das ist gefährlich, denn letztlich ist eine Klimapolitik, die nur auf (vermeintliche) Akzeptanz schaut und dabei die Klimaziele verfehlt, erst recht nicht erfolgreich.