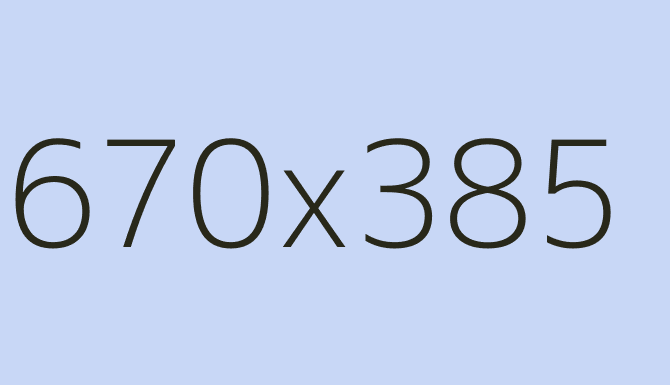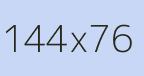Gesundheitsinformation findet zunehmend im Web statt. Jede 20. Suchanfrage bei Google hat einen Gesundheitsbezug. Mehr als die Hälfte der deutschen Onliner suchen mindestens ein Mal im Jahr online nach Informationen zu Erkrankungen und Behandlungen. Doch – so zumindest die weit verbreitete Annahme – die Menschen finden im Dschungel aus Informationen nicht das, was sie suchen und werden unnötig verwirrt. Oder: Sie werden konfrontiert mit sachlich falschen und irreführenden Informationen. Ein Nationales Gesundheitsportal soll das Problem lösen. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) beauftragt, ein Konzept für ein solches Portal zu entwickeln. Was ist davon zu halten? Weil wir das Vorhaben der Bundesregierung konstruktiv-kritisch begleiten wollen, haben wir unsere Gedanken zu einem Nationalen Gesundheitsportal in zehn Thesen gebündelt. Unsere Thesen erheben keinen absoluten Gültigkeitsanspruch, sie spiegeln unseren aktuellen Diskussionsstand wider.

Markus Spiske / Unsplash - Unsplash License, https://unsplash.com/license
10 Thesen zum Plan eines Nationalen Gesundheitsportals
Viele Menschen suchen online nach Informationen zu Erkrankungen und Behandlungen. Doch – so zumindest die weit verbreitete Annahme – die Menschen finden im Dschungel aus Informationen nicht das, was sie suchen und werden unnötig verwirrt. Ein Nationales Gesundheitsportal soll das Problem lösen. Wir haben unsere Gedanken dazu in 10 Thesen zusammengefasst. (Stand: 15.1.2018)
Inhalt
Zu den Prämissen und Erwartungen an ein nationales Informationsangebot
1. An Bedürfnissen der Nutzer orientieren
Ein adäquater Vermittlungsansatz muss sich zuallererst mit den Bedürfnissen der Nutzer auseinandersetzen. Anders als häufig vorausgesetzt, suchen Patienten im Web in vielen Fällen nicht primär nach evidenzbasierten Fakten, um Entscheidungen in Gesundheitsfragen zu treffen – das Internet deckt keineswegs nur rationale Bedürfnisse ab. Vielmehr sind oft (emotionale) Absicherung oder „Trost“ das Motiv für eine Online-Recherche.
Eine eigene Studie zeigt, dass Patienten das oben beschriebene Defizit des Nicht-Findens von passenden Informationen selbst gar nicht ausgeprägt wahrnehmen; sie sind mit dem aktuellen Informationsangebot im Web zufrieden. Die Online-Aktivität von Patienten ist häufig psychologisch motiviert. Ein Portal, das auf die rein sachliche Vermittlung von Inhalten setzt, könnte dieses Bedürfnis nicht vollständig erfüllen. Zudem sind die Motive und Erwartungshaltungen so unterschiedlich, dass es ein „One-fits-all“ in der Vermittlung nicht geben kann. Eine qualitätsorientierte Vielfalt ist gefragt.
2. Solide Informationsangebote existieren
Die heute im Web verfügbaren Informationen sind in vielen – nicht allen – Fällen sachlich richtig und an aktueller Evidenz orientiert. Das gilt insbesondere auch für viele reichweitenstarke Portale. Die Güte des existierenden Informationsangebots ist – auch jenseits des individuellen Empfindens der Nutzer (siehe These 1) – demnach keine hinreichende Begründung für einen neuen zentralen Ansatz.
Eine Analyse für die Zeitschrift „Ökotest“ hat gezeigt, dass die Qualität vieler prominenter Seiten insgesamt „solide bis sehr gut ist“. Hinzu kommt: Vor allem die reichweitenstarken kommerziellen Medien oder die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks arbeiten mit hohen redaktionellen Standards und greifen häufig auf ebenso inhaltlich gute Informationen zurück wie spezifische öffentlich-rechtliche Informationsanbieter bzw. die Angebote der System-Akteure. Sie haben zudem häufig die höhere Erfahrung und Kompetenz, Informationen so zu verbreiten und zu vermitteln, dass sie verständlich und handlungsrelevant für Patienten sind. Kommerzielle Ansätze sind allerdings dann problematisch, wenn das Geschäftsmodell die Neutralität der angezeigten Informationen in Frage stellt.
3. Marktlogiken lassen sich nicht außer Kraft setzen
Ein zentrales Portal allein wird nicht dafür sorgen, dass Patienten nicht mehr mit „schlechten“ oder falschen Informationen konfrontiert werden. Denn das Portal wird die bisherigen Marktlogiken nicht außer Kraft setzen. Zudem werden Patienten – bei dem Versuch, kognitive Dissonanz zu vermeiden – weiter die Information finden, die sie suchen. Daher stellt sich die Frage, wie Online-Nutzer vor Desinformation geschützt werden können.
Bedeutendster Einstiegspunkt für die Suche nach Online-Gesundheitsinformationen ist Google. Bei ihrer Online-Recherche suchen Patienten häufig gezielt nach Informationen, die ihnen Sicherheit geben, ihr Handeln oder ihre Einstellung bestätigen. Wer zum Beispiel nach Bestätigung einer impfkritischen Einstellung sucht, wird die dazu passende Information finden – allein schon, weil seine Suchhistorie das Suchergebnis bestimmt und seine Eingabe in die Suchmaschine den Algorithmus entsprechend „füttert“. Ein zentrales Portal verhindert diesen Mechanismus nicht. Vielmehr sollte darüber diskutiert werden, was der richtige Umgang mit (gezielt platzierten) Falschinformationen im Web ist – wie diese gezielt „bekämpft“ werden können.
4. Zentrales Portal nicht durch hohe Vertrauenswerte zu rechtfertigen
Ein zentrales bundesdeutsches Portal wird hohe Vertrauenswerte erzielen. Das allein reicht als Begründung aber nicht aus. Denn schon heute erzielen viele Informationsangebote hohe Vertrauenswerte – zum Beispiel abhängig von ihrer Gestaltung oder der Bekanntheit ihrer Absendermarke.
Eine häufig vertretene These lautet, dass Patienten nicht einschätzen können, welchen Informationen im Web sie vertrauen können. Allerdings genießen schon heute viele Angebote im Web hohes Vertrauen ihrer Nutzer – insbesondere die reichweitenstarken kommerziellen Angebote. Auch weniger seriöse Portalanbieter können etwa durch ihre Gestaltung Vertrauenswürdigkeit „vorgaukeln“. Ein zentrales Portal wird diese Effekte nicht (allein) aushebeln – auch deshalb braucht es eine Strategie im Umgang mit Desinformation im Web (siehe These 3).
5. Erfolgreiche Vorbilder sind mit Patientenakten gekoppelt
Bei weitem nicht alle Länder mit staatlichen Gesundheitsportalen sind gute Vorbilder in Bezug auf ihren Ansatz. Am erfolgreichsten dürften diejenigen sein, die ihren Vermittlungsansatz weitestgehend entlang der Nutzerbedürfnisse aufgebaut haben.
Ist der Verweis auf andere Länder und ihre zentralen Portale eine gute Begründung für ein Nationales Gesundheitsportal in Deutschland? In einer aktuellen Analyse untersuchen wir, wie erfolgreich verschiedene bestehende nationale Online-Informationsangebote sind, unter anderem blicken wir zum NHS, nach Dänemark und nach Australien. Ziel ist es, Erkenntnisse für die deutsche Debatte abzuleiten. Eine unserer Thesen: Vor allem dürften diejenigen Länder erfolgreich sein, die die Logik von individuellen Patientenakten verbunden haben mit möglichst personalisierten Gesundheitsinformationen (siehe These 9). Hinzu kommt: Einige Gesundheitssysteme mit nationalen Portalen sind zentral organisiert – die Patienten sind es gewohnt, sich an eine zentrale Stelle zu wenden. Das ist in Deutschland nicht der Fall.
6. Nicht mit Ansprüchen überfrachten
Man sollte ein Nationales Gesundheitsportal nicht mit Ansprüchen überfrachten. Ein solches Portal allein wird nur bedingt dazu beitragen, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu erhöhen. Denn mit einer reinen Portallösung werden die Bevölkerungsgruppen mit einer mangelnden Health Literacy nicht erreicht.
Eine – zumindest vereinzelt geäußerte – Hoffnung im Zusammenhang mit der Portallösung lautet, dass sich dort „die bis dato ausgegrenzten Gruppen“ informieren, also diejenigen mit einer niedrigen Health Literacy. Um ein solches Ziel zu erreichen, braucht es integrierte Ansätze, die im Schwerpunkt auf persönliche Informationsvermittlung setzen – durch Ärzte im Rahmen des Shared Decision Making oder z. B. durch Case Manager. Die Online-Informationen wären dabei (maximal) Ergänzung oder Vertiefung. Das allein wird schon deutlich, wenn man etwa auf den hohen Anteil von 14 Prozent der Bevölkerung mit funktionalem Analphabetismus schaut.
Zu möglichen Lösungen für die Umsetzung
7. Bündelung und Konsolidierung von Informationen bedeutet (Zielgruppen-)Ansatz neu zu definieren
Ein Informationsangebot, in dem „gute“, evidenzbasierte Informationen gesammelt und auffindbar gemacht werden, kann im Grundsatz ein Fortschritt gegenüber dem Status quo sein. Insbesondere Intermediäre, z. B. in der Patientenberatung, könnten hier an einer Stelle die Informationen finden, die für ihre Arbeit relevant sind.
Vor allem im Kontext der Beratung zu Behandlungsentscheidungen ist es für Patientenberater und Ärzte heute oft schwierig, im Web die Informationen zu finden, die im jeweiligen Fall dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens entsprechen. Hinzu kommt: Teilweise widersprechen sich die Informationsangebote von System-Akteuren in ihren Empfehlungen. Eine Bündelung und Konsolidierung könnte zur Verbesserung des Status quo beitragen. Allerdings würde das bedeuten, den (Zielgruppen-)Ansatz des Informationsangebots neu zu definieren.
8. Technologische Entwicklungen antizipieren
Die Logik eines klassischen „Portals“ entspricht nicht der Entwicklung des Informationsmarkts und dürfte bei Fertigstellung eines Nationalen Gesundheitsportals schon überholt sein. Absehbar werden Informationsangebote immer individueller, künstliche Intelligenz und algorithmische Diagnose-Tools werden in der Vermittlung eine zentrale Rolle spielen. Diese Entwicklung ist schon bei der Konzeption zu beachten.
Ein Konzept für ein nationales Informationsangebot sollte technologische Entwicklungen (auch im Bereich der verwendeten Endgeräte) und Entwicklungen auf dem Informationsmarkt früh antizipieren und mit aufgreifen. Der Ansatz muss von Anfang an hinreichend „anpassungsoffen“ sein. Als negatives Vorbild kann hier die elektronische Gesundheitskarte fungieren, deren technisches und inhaltliches Konzept im Laufe der Jahre von der Dynamik der Entwicklung überholt wurde.
9. Gesundheitsinformationen dort anbieten, wo die Nutzer sind
Ein Nationales Gesundheitsportal würde auch künftig im Wettbewerb mit anderen Informationsangeboten stehen. Wenn eine Marktführer-Position angestrebt wird, braucht es einen starken, Nutzer-bindenden Charakter. Anders: Gesundheitsinformationen sollten dort vermittelt werden, wo sich Nutzer regelmäßig „aufhalten“ und wo Informationsbedarf entsteht („point of interest“). Das sind Plattformen wie Google oder – die in Entwicklung befindlichen – Patienten- bzw. Gesundheitsakten.
Ein Großteil derjenigen, die online nach Gesundheitsinformationen suchen, steigen über Suchmaschinen ein. Der Absender „Bund“ dürfte nach den Kriterien, die Suchmaschinen derzeit anlegen, ein gutes Suchmaschinen-Ranking erzeugen, wird aber allein nicht ausreichen. Schon in der Konzeption muss die Findbarkeit in Suchmaschinen eine zentrale Rolle spielen, negative Implikationen (z. B. durch den so genannten „Duplicate Content“ bei einem Mashup-Ansatz) müssen ausgeschlossen werden. Hinzu kommt: Google plant ein eigenes Gesundheitsinformationsangebot auch in Deutschland, in den USA und anderen Ländern existiert dieses schon – teils auch in Kooperation mit gemeinnützigen Einrichtungen. Hier entsteht ein starker und dominanter „Wettbewerber“ für öffentlich-rechtliche Informationsangebote. Wenn diese Reichweite erlangen wollen, empfiehlt sich Dialog und Kooperation mit Google. Hierbei könnten alle deutschsprachigen Länder zusammenarbeiten. Nutzerbindung kann zudem hergestellt werden, wenn man die Planungen zu einrichtungsübergreifenden Elektronischen Patientenakten mit den Planungen zur Vermittlung evidenzbasierter Informationen im Sinne einer Behandlungsmanagement-Plattform zusammenbringt. Denn hier, wo die Informationen zum Gesundheitszustand eines Patienten zusammenfließen und der weitere Behandlungsprozess geplant wird, entsteht der Informationsbedarf beim Patienten. Hier könnten – ohne „Umweg“ einer Suchmaschinen-Recherche durch den Patienten – evidenzbasierte Informationen kontextsensitiv angeboten werden. Denkt man dieses Szenario weiter, könnte die Gesundheitsinformation oder Entscheidungshilfe sogar auf den Patienten zugeschnitten sein – indem zum Beispiel dessen Alter, Geschlecht oder Vorerkrankungen berücksichtigt werden.
10. Erstellung und Verbreitung in professionelle Hände geben
Ein nationales Informationsangebot sollte von Experten für Vermittlung und Verbreitung von Informationen entwickelt und betrieben werden. Die Erstellung von Inhalten sollte organisatorisch oder mindestens personell von dieser Aufgabe getrennt werden.
Angesichts der rasanten digitalen Entwicklung, die stetig neue Informationsansätze hervorbringt und die Rezeptionsgewohnheiten der Nutzer ändert, erfordert der Betrieb eines Informationsangebots für Verbraucher eine spezifische Kompetenz. Zudem sind für die Verbreitung ausreichend Ressourcen vorzuhalten. Ein im Kontext öffentlicher Qualitätsberichterstattung in anderen Ländern beobachtbares Arbeitsteilungsmodell könnte sein, dass öffentlich-rechtliche Institutionen sich künftig „nur“ noch auf die Produktion von Inhalten im Sinne von „Rohtexten“ konzentrieren und die produzierten Informationen zur weiteren Verarbeitung und Vermittlung durch Dritte zur Verfügung stellen – zum Beispiel über die Elektronische Patientenakte (siehe These 9). Oder anders: Statt mit einem neuen Angebot „in Konkurrenz“ mit existierenden Qualitätsmedien zu treten, könnten diese gezielt gefördert werden. In diesem Kontext stellt sich überdies die Frage, in wie weit der Status quo gerechtfertigt ist, bei dem viele verschiedene Organisationen mit Steuermitteln oder Versichertengeldern Informationen zu denselben Indikationen und Sachverhalten produzieren.