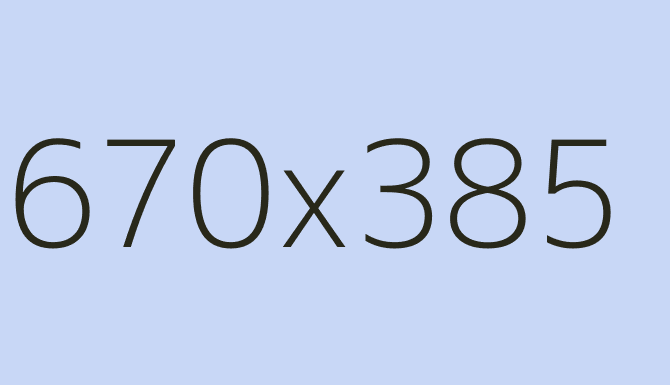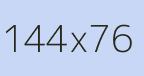Bei aller berechtigten Kritik am Kurs Xi Jinpings lässt sich Chinas Aufstieg zur globalen Wirtschaftsmacht nicht wegwünschen und bietet vielen Ländern des Globalen Südens Entwicklungsperspektiven. Anstatt sich in rhetorischer Selbstversicherung zu üben, sollte die EU ihre eigene Markt- und Regulierungsmacht zur Verteidigung globaler Standards bei Menschenrechten, Klima- und Umweltschutz nutzen und auf dieser Basis neue Kooperationsangebote im Sinne der Umsetzung der UN-2030-Ziele machen.
Xi Jinpings China stellt Deutschland und die Europäische Union (EU) vor eine Reihe neuer und komplexer Herausforderungen. Jahrzehntelang profitierten europäische und allen voran deutsche Unternehmen von der wirtschaftlichen Aufholjagd Chinas, die ihnen günstige Produktionsbedingungen und einen rasant wachsenden Absatzmarkt bot. Politisch hoffte man dabei, dass China sich mit zunehmendem Wohlstand liberalisieren und dem Westen „gleicher“ werden, das autoritäre Regime keinen Bestand haben würde. Das ist nicht eingetroffen: China unter Führung der Kommunistischen Partei (KPCh) bleibt „the land that failed to fail“.
Im Gegenteil, die KPCh sieht sich durch die Krisen demokratischer Gesellschaften – von der Finanzkrise und der Flüchtlingskrise zu Rechtspopulismus, Corona-Pandemie und Volksaufständen im Herzen des „Westens“ – im eigenen Modell bestärkt. Peking tritt heute mit dem Anspruch auf, die Spielregeln des 21. Jahrhunderts (mit)zubestimmen. Die existierende multilaterale Ordnung bezeichnen KPCh-Politideologen als nicht „fair“ und „den engen Interessen einer Gruppe“ westlicher Staaten dienend – und erhalten hierfür Zustimmung in großen Teilen der vormals von Europa kolonisierten Welt. Dem setzt China mit der „Belt and Road Initiative“ (BRI) einen Multilateralismus chinesischer Prägung entgegen, der nicht auf allgemein gültigen Regeln, sondern auf bilateralen Konsultationen und Interessenabwägungen basiert. Qiutong cunyi, „Gemeinsamkeiten suchen, Differenzen beibehalten“, ist das Motto. Der Universalität der Menschenrechte stellt Peking eine Hierarchie der Menschenrechte – mit dem Recht auf Entwicklung als dem höchsten – gegenüber und hat es geschafft, dieses per Resolution im UN-Menschenrechtsrat zu etablieren.
Die vier Jahre US-amerikanischer Selbstdemontage unter Donald Trump und dessen Rückzug aus wichtigen globalen Abkommen konnte Peking in seinen Beziehungen mit Ländern des Global Südens strategisch nutzen – ungeachtet der Kritik an zunehmenden Repressionen im eigenen Land oder irredentistischen Manövern im Südchinesischen Meer. China positioniert sich als verantwortungsvolle Großmacht: als Partner und Entwicklungsmodell in Süd-Süd-Kooperationen, als Garant dringend benötigter Investitionen, als entwicklungsorientierter Unterstützer bei der Anpassung an den Klimawandel oder als Helfer im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Letzteres zu einem Zeitpunkt, da die EU, Großbritannien und die USA in der Kritik stehen, 70% der global verfügbaren Impfstoffe aufgekauft zu haben.
Die EU wirkt ratlos und getrieben
Angesichts des eskalierenden amerikanisch-chinesischen Großmachtkonflikts stehen auch in Europa die Zeichen zunehmend auf Konfrontation mit der aufstrebenden Weltmacht. Gleichzeitig wirkt die EU bisweilen seltsam ideenlos und reaktiv. Die Kombination aus diffusen Ängsten vor Chinas Übermacht, real zunehmender wirtschaftlich-technologischer Konkurrenz und der dramatischen Ausweitung politischer Repressionen von Xinjiang bis Hongkong haben die öffentliche Meinung gegenüber China antagonisiert und zur Polarisierung der Chinadebatte beigetragen. Im Wertekonflikt mit dem „systemischen Rivalen“ China werden dabei immer öfter dichotome entweder-oder-Entscheidungen konstruiert: Kooperation oder Konfrontation, Wirtschaftsinteressen oder Menschenrechte, Investitionsabkommen mit China oder engere transatlantische Abstimmung und „Entkopplung“.
Die Landkarte der europäischen Chinadebatte wird durch das Dreieck EU-China-USA bestimmt. Die Länder des Globalen Südens kommen darauf kaum vor. Wenn sie Erwähnung finden, dann vor allem als Opfer von Chinas „Ressourcenhunger“ oder seiner „Schuldenfallendiplomatie“. Diese ist im westlichen Diskurs zum Synonym für Chinas globales Engagement geworden, obwohl der Vorwurf gezielter „Schuldenfallen“ in der Forschung widerlegt ist. Chinas Entwicklungskredite sind mitnichten problemfrei: Die Fragmentierung der chinesischen Entwicklungsfinanzierung bedingt einen Grad an Intransparenz, der für Partnerländer wie auch für China Gefahren birgt – Überschuldung auf der einen, kostspielige Kreditausfälle auf der anderen Seite. Doch die Reduktion von Chinas Präsenz im Globalen Süden auf das Ressourcen- und Schuldenfallennarrativ ist problematisch, denn sie spricht den Partnerländern chinesischer Projekte implizit selbstbestimmtes Handeln (agency) ab.
Dabei wirkt die europäische Politik selbst bisweilen wie von China getrieben. Die EU-Asien-Konnektivitätsstrategie etwa scheint eher das China-Problem der EU zu adressieren, als die mangelnde Konnektivität zwischen Europa und Asien als ein gemeinsames Problem zu begreifen. In Afrika entfaltet die europäische Haltung gegenüber chinesischen Initiativen eine ähnliche Wirkung. Der frühere liberianische Minister für öffentliche Arbeiten W. Gyude Moore attestiert der EU, dass es dieser vollkommen an Vorstellungskraft in Bezug auf Zusammenarbeit mit Afrika fehlte – bis China kam. Niemand sei so nah an Afrika, und doch gab es nie einen europäischen Plan für eine transkontinentale Infrastruktur, geschweige denn einen Blick auf Afrika als potentiellem Wirtschaftspartner. Selbst wenn China mit der BRI scheitern sollte, gehe von der Initiative eine unglaubliche Innovation im Denken über Entwicklung und darüber aus, wie man die ärmsten Länder der Welt mit den reichsten verbindet.