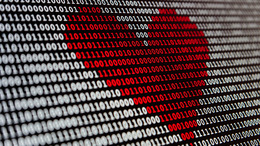Das Virus zwingt die Unternehmen, Neues auszuprobieren und Lösungen für die Weiterführung der täglichen Arbeit herbeizuführen, die - zumindest in Bezug auf die Arbeitswelt - so eigentlich neu nicht sind.
Ihnen fehlte es zumeist an Legitimation durch die Arbeitgeber und sie wähnten sich in sicherem Fahrwasser, wenn sie zwar zaghaft den Zeichen der Digitalisierung Rechnung trugen, aber gewohnheitsmäßig Kontrolle vor Vertrauen setzten und zum Beispiel - vor der Krise - auf die Präsenzkultur beharrten. Die Pandemie wirft nun aber gewohnte Muster vollkommen durcheinander und Unternehmen müssen sich für neue Arten des Arbeitens öffnen. Zwei Drittel der ExpertInnen gehen auch künftig von der Auflösung des Büroalltags aus, ein Drittel vermutet, dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss. Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, dass zukünftig nicht die eine Lösung für Alle das Arbeiten bestimmen wird, sondern eine Balance aus virtueller und physisch präsenter Bürokultur gefunden werden muss. Die Diversität der Arbeitsweisen wird als eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Corona-Krise in die „alte“ Arbeitswelt hineinreichen. Die Zeit ist anscheinend reif für den Beschäftigten, der dort, wo es möglich ist, und in Abstimmung mit den Teamkolleginnen selbst als mündiger Arbeitnehmer festlegt, wo er seine Arbeit gerade am besten ausführen kann.
Der Trend zum Arbeiten außerhalb des Büros wird auch die zukünftige Organisation von Arbeitsprozessen erheblich verändern. 44 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sich die Führungskultur von Kontrolle hin zu Vertrauen wandeln wird. Das bedeutet besonders für traditionelle und hierarchisch aufgestellte Unternehmen eine gravierende Umstellung, speziell was die Mitarbeiterführung betrifft.
Die zweite deutlich erkennbare Tendenz aus den Antworten der ExpertInnen ist, dass die durch die Pandemie hervorgerufenen positiven Effekte für die Nachhaltigkeit einer digitalen Arbeitskultur wie z.B. weniger Dienstreisen, weniger Flüge, ein geringeres Verkehrs- bzw. Pendleraufkommen, das Andauern der Stadtflucht, die allgemeine Entschleunigung und die verstärkte Wahrnehmung der Bedürfnisse anderer keine langfristige – also nachhaltige Wirkung haben werden. Nur 17 Prozent der Befragten erwarten, dass die Menschen auch nach Überwindung der Krise einem nachhaltigeren Lebens- und Arbeitsstil folgen werden.