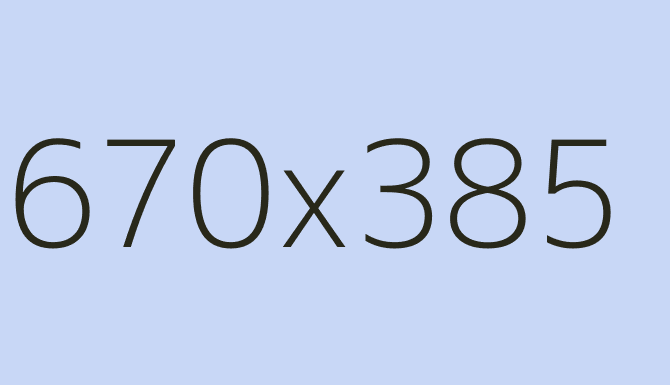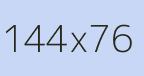anika.sina.laudien@bertelsmann-stiftung.de
+49(5241)81-81246

_dChris / flickr - CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Europa braucht China - aber das gilt auch umgekehrt
Ab dem 11. Dezember erwartet China von der EU, wie ein Land mit Marktwirtschaftsstatus behandelt zu werden – so wie es Peking 2001 beim WTO-Beitritt in Aussicht gestellt wurde. Damit verbunden ist die Sorge, dass europäische Unternehmen bald nicht mehr ausreichend vor chinesischen Billigexporten geschützt sind. Jedoch geht es um mehr als ökonomische Effekte. Es ist auch ein politisches Machtspiel.
Am 11. Dezember 2001 trat China der Welthandelsorganisation WTO bei. Heute ist das Land die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und gewinnt auch politisch an Bedeutung. Trotz des fulminanten wirtschaftlichen Aufstiegs hat sich China aber nicht in eine Marktwirtschaft verwandelt – zumindest nicht nach westlichen Standards. Planwirtschaftliche Elemente und staatliche Eingriffe sind Teil des Systems. Deshalb hat die EU China bislang keinen Marktwirtschaftsstatus gewährt. EU-Mitglieder durften gegenüber chinesischen Exportunternehmen großzügigere Regeln bei der Festlegung von Anti-Dumping-Zöllen anwenden. Diese 15-jährige Übergangsregelung läuft zum 11. Dezember aus. Chinesische Exporte in die Europäische Union müssten dann so behandelt werden wie Exporte aus einem Land mit Marktwirtschaftsstatus.
Politik und Industrie haben in der Debatte immer wieder Bedenken geäußert, dass europäische Unternehmen dann nicht mehr ausreichend vor billigen chinesischen Exporten geschützt sein würden. Diese Sorge ist nicht unberechtigt, auch wenn die ökonomischen Effekte tatsächlich gering ausfallen würden: Unsere aktuelle Studie zeigt, dass nur drei Prozent aller chinesischen Exporte in die EU überhaupt von Dumping betroffen sind. Selbst im Extremfall, in dem jegliche Schutzzölle auf chinesische Produkte wegfallen, würden Chinas Exporte in die Europäische Union um lediglich ein Prozent zunehmen. Von einer Billigimportschwemme kann also keine Rede sein. Jedoch geht es hierbei um mehr als ökonomische Effekte: Die EU befindet sich in dem Dilemma, einerseits ihren internationalen Verpflichtungen im Rahmen der WTO nachkommen, andererseits aber auch ihre Unternehmen weiterhin vor unfairem Wettbewerb schützen zu müssen.
Im Zuge der Debatte hat die EU-Kommission im November 2016 einen Änderungsvorschlag für die Anti-Dumping-Regeln vorgelegttypo3/#_msocom_1: Nach diesem soll nicht mehr zwischen Ländern mit und ohne Marktwirtschaftsstatus unterschieden, sondern ein länderneutrales Verfahren bei der Festlegung von Anti-Dumping-Zöllen eingeführt werden. Der Kommission zufolge bleibt ausreichend Schutz gegenüber von Dumping betroffenen Importen bestehen.
Eine strittige Frage ist allerdings die Vereinbarkeit der neuen Regeln mit der WTO-Gesetzgebung, unter anderem im Hinblick auf das Prinzip der Nichtdiskriminierung. Peking hat bereits angekündigt, hier keine Kompromisse einzugehen und will ab dem 11. Dezember nicht mehr akzeptieren, in Anti-Dumping-Verfahren gesondert behandelt zu werden. Die Chinesen erwarten damit von ihren Handelspartnern, dass sie sich an die im Rahmen des chinesischen WTO-Beitritts getroffenen Vereinbarungen halten.
Chinas Argumentation erschwert es Brüssel, mit den Herausforderungen, die das politische und wirtschaftliche System des Landes nach wie vor mit sich bringt, umzugehen. Zwar hat sich der asiatische Staat seit dem WTO-Beitritt besonders im Handel deutlich geöffnet. Jedoch bestehen für ausländische Investoren 15 Jahre später noch immer formale und informelle Barrieren für den Markteintritt. In manchen Sektoren, wie der Automobilbranche, besteht ein Zwang zu Gemeinschaftsunternehmen. In anderen Sektoren, wie der Finanzbranche, dürfen ausländische Investoren nur über Minderheitsbeteiligungen oder gar nicht investieren. Der Schutz geistigen Eigentums ist nicht ausreichend gewährleistet und verschafft chinesischen Unternehmen zum Teil unfaire Wettbewerbsvorteile, etwa wenn ausländische Partner in einem Gemeinschaftsunternehmen Patente offenlegen müssen. Die massiven Überkapazitäten, zum Beispiel in den Bereichen Stahl, Keramik und Aluminium, werden zu langsam abgebaut. Chinesische Unternehmen könnten auch in Zukunft versuchen, diese auf den europäischen Märkten unterhalb der Marktpreise abzustoßen. Handelskonflikte sind dadurch möglicherweise vorprogrammiert.
Diese Herausforderungen zeigen, dass die Reformprogramme, die China unter Staatspräsident Xi Jinping auf den Weg gebracht hat, nur teilweise in eine aus europäischer Sicht wünschenswerte Richtung gehen und an vielen Stellen nicht konsequent umgesetzt werden. Europäische Unternehmen beklagen sich so berechtigterweise über fehlende Gleichbehandlung und Kooperation auf Augenhöhe. China hält dagegen, dass es als größtes Entwicklungsland der Welt Zeit brauche, um sein Wirtschaftssystem zu restrukturieren und in Richtung mehr Binnenkonsum, höhere Technologieintensität und größere Nachhaltigkeit umzubauen. Hiervon könnten europäische Unternehmen profitieren, wenn gewährleistet wäre, dass China ihnen endlich Wettbewerb auf Augenhöhe mit einheimischen Unternehmen zugesteht – und zwar auch in Sektoren, in denen das bislang nicht der Fall war. Doch die Vorzeichen deuten in eine andere Richtung. So sagen europäische Unternehmen, die in China tätig sind, dass sich dort die Rahmenbedingungen für ausländische Investoren in letzter Zeit sogar eher verschlechtert haben.
Umgekehrt bietet die EU chinesischen Investoren freien Marktzugang und faire Rahmenbedingungen, die diese typo3/#_msocom_2auch gerne für sich nutzen. Da chinesische Unternehmen gezielt in europäische High-Tech-Branchen investieren, stellt sich zunehmend die Frage, wie sich das langfristig auf Europas Position in globalen Wertschöpfungsketten auswirken wird, wenn europäische Unternehmen nicht den gleichen Zugriff auf chinesische High-Tech-Branchen haben. Aufgrund der Größe der chinesischen Volkswirtschaft haben diese Entwicklungen für die EU eine Tragweite, die nicht zu unterschätzen ist. Jenseits der Frage, welche Anti-Dumping-Regeln in Zukunft gelten werden, stellt der künftige Umgang mit China einen gewichtigen Faktor für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg Europas dar.
Die politisierte Debatte um Chinas Marktwirtschaftsstatus hat gezeigt, welche politischen Aufgaben auf Europa zukommen, je mehr das asiatische Land zu einem wichtigeren und mächtigeren Partner für Deutschland und die EUavanciert. China will international als globaler Akteur anerkannt werden. Aus europäischer Sicht muss es dann aber nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten einer solchen Rolle wahrnehmen. Auch wenn die Handlungsspielräume für Europa bereits heute begrenzt sind, besteht eine gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit. Bevor sich das Machtverhältnis aber zu Gunsten Chinas verschiebt und die Handlungsspielräume enger werden, sollte sich die EU auf eine konsequente China-Strategie einigen und taktisch unkluge wie unstrukturierte Debatten, die das Verhältnis zu Peking unnötig belasten, vermeiden. Das ist wegen der unterschiedlichen Interessen in der Europäischen Union keine leichte Aufgabe. Es ist aber für alle Akteure von Vorteil, sich in Kernbereichen zu einigen, damit die EU glaubwürdig und selbstbewusst gegenüber China auftreten und langfristig Wettbewerbsgleichheit einfordern kann.
Das Ergebnis der US-Wahl könnte hierfür ein passendes Zeitfenster schaffen. Da der Sieg Donald Trumps für erhebliche Unsicherheit sorgt, könnte die EU die Chance ergreifen, um ein engerer Schlüsselpartner für China zu werden und die Beziehungen für beide Seiten positiv zu gestalten. Auf diese Weise könnten auch die Forderungen Brüssels nach Gleichbehandlung und Kooperation auf Augenhöhe mehr Gewicht bekommen.
Ein Kommentar von Cora Jungbluth und Anika Laudien