In der folgenden Liste finden Sie die vergangenen Ausgaben des Policy Briefs in deutscher und englischer Sprache. Klicken Sie auf einen der Titel um die jeweilige Ausgabe als PDF herunterzuladen.
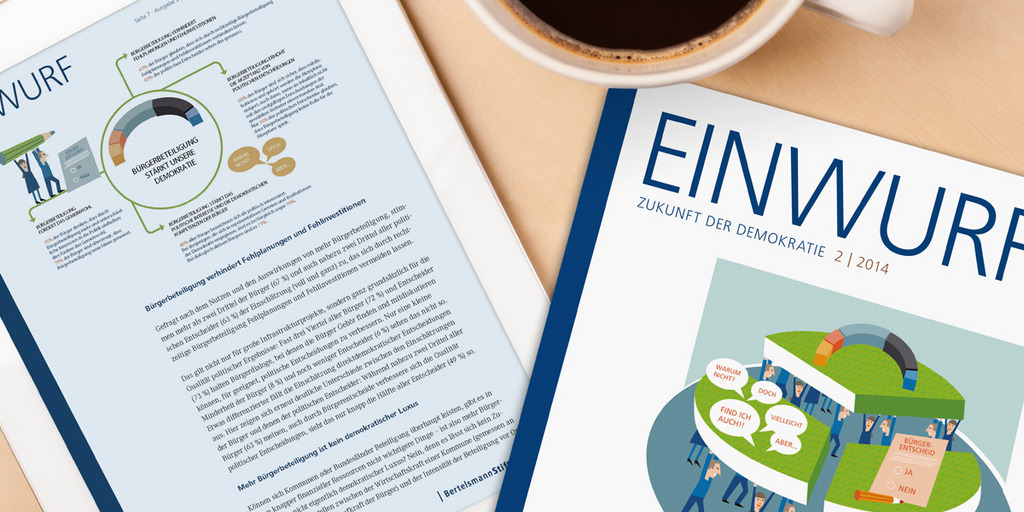
ra2studio / Shutterstock Images
EINWURF
„Der EINWURF ist ein Policy Brief der Bertelsmann Stiftung. Er befasst sich in 6-8 Ausgaben pro Jahr mit aktuellen Themen und Herausforderungen der Zukunft der Demokratie. Schwerpunkte sind Fragen der politischen Teilhabe, der Zukunft von Parteien und Parlamenten, der Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung demokratischer Politik sowie neuen Formen der direkten Demokratie."






