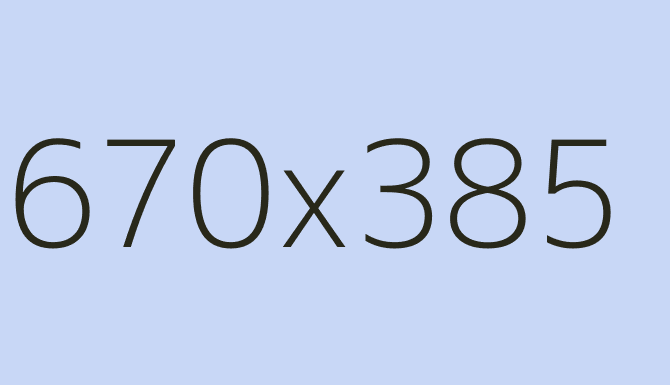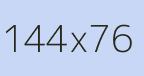Text von Steffan Heuer für change – das Magazin der Bertelsmann Stiftung. Ausgabe 3/2016 (gekürzte Fassung).

David Magnusson
Asiaten in den USA: Konstante Anziehungskraft
Das Silicon Valley lockt zahlreiche Fachkräfte aus China und Indien an und bindet sie langfristig. Viele bleiben in den USA. Wir haben einige getroffen.
Infos zum Text
Die Liste prominenter Inder, die Weltmarken der High-Tech-Industrie groß gemacht haben oder leiten, ist beeindruckend. Sundar Pichai steht an der Spitze von Google, Satya Nadella ist CEO von Microsoft und Shantanu Narayan leitet Adobe. Padmasree Warrior war erst Cheftechnologin von Motorola, dann beim Networking-Unternehmen Cisco und leitet derzeit den Elektromobilitäts-Anbieter Next EV. Während des ersten Booms von Technologieunternehmen gründete Sabeer Bhatia den Webmail-Dienst Hotmail, der später von Microsoft aufgekauft wurde. Vinod Khosla schließlich schrieb als einer der Gründer von Sun Microsystems Geschichte.
Wissenschaftler versuchten den Unternehmergeist von Einwanderern im Silicon Valley mehrfach zu messen und gelangten zu beeindruckenden Ergebnissen. Die Region im Süden von San Francisco zählt rund drei Millionen Menschen, von denen knapp die Hälfte im Ausland geboren ist. Unter Arbeitnehmern im Bereich Informatik und Mathematik liegt dieser Anteil sogar bei 73,6 Prozent. Und obwohl Inder nur rund sechs Prozent aller Beschäftigten im Valley ausmachen, hat keine Einwanderergruppe mehr Tech-Firmen ins Leben gerufen.
In Deutschland sieht die Situation anders aus: Nach jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) von 2015 lagen Chinesen mit knapp 45.000 von 856.480 bundesweit erteilten Aufenthaltstiteln hinter der Türkei und Syrien auf Platz drei. Auf Platz sechs folgten Inder mit fast 30.000 Aufenthaltstiteln. Dass Studenten und hochqualifizierten Arbeitskräften aus Asien zuwandern hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, um einen Mangel an Fachpersonal und eine Überalterung der Bevölkerung aufzufangen. Schon jetzt fehlen in der Bundesrepublik jährlich rund 33.000 Fachkräfte in Mathematik, Informatik, anderen Naturwissenschaften und Technik.
Viele Asiaten kommen über die "Blue Card" nach Deutschland
Um Europa für Fachkräfte attraktiver zu machen, schuf die EU 2012 eine "Blue Card", ein Aufenthaltsdokument für Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten – ähnlich der "Green Card" in den USA. Als das Forschungszentrum des BAMF 2015 die Fachtagung "Potenziale der Migration aus Indien" veranstaltete, wies es darauf hin, dass Deutschland mit bisher 23.000 erteilten Blauen Karten der Spitzenreiter in der EU ist und mehr als ein Fünftel dieser Karten an Inder gingen. Auch die Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich in ihrem Projekt "Deutschland und Asien" mit der Frage, wie Migration erfolgreich gestaltet werden kann. "Neben den harten Faktoren wie Visa und rechtlichen Fragen sind eine ganze Reihe von weichen Faktoren wichtig", sagt Asienexperte Bernhard Bartsch. "Dazu gehören die Sprachbarriere, die man überwinden muss, kulturelle Details wie das Essen und andere kleine und große Dinge des Alltags." Wer beispielsweise auf ein enges Netzwerk aus Landsleuten zugreifen kann, fühlt sich nicht alleine auf weiter Flur. Für viele Studenten aus China oder Indien ist laut Bartsch die Rückkehr in die Heimat verlockender geworden, da sich dank des anhaltenden Wirtschaftswachstums neue Karrierechancen auftun.
Inder als Start-up-Gründer in den USA ganz weit vorne
Wer hingegen in den USA arbeitet, beispielsweise im Silicon Valley, der bleibt. Laut einer Studie des US-Professors Vivek Wadhwa gründeten Inder zwischen 1999 und 2012 jedes siebte Start-up – mehr als die Gründer aus den nächsten vier Herkunftsländern Großbritannien, China, Taiwan und Japan zusammen. "Ohne diesen erstaunlichen Zustrom an Einwanderern gäbe es das Valley heute nicht", sagt Marc Andreessen, der erst mit Netscape Web-Geschichte schrieb und heute einen der wichtigsten Wagniskapital-Fonds leitet.
Dieser sich beständig erneuernde Pool aus gebildeten, neugierigen und ehrgeizigen Menschen aus aller Welt, einschließlich ihrer kulturellen und kulinarischen Interessen, zieht Hochqualifizierte aus Asien und ihre Familien ins Silicon Valley und erleichtert es ihnen, in der neuen Heimat zu bleiben.
Inder können im Silicon Valley beispielsweise auf das bereits 1992 gegründete "The Indus Entrepreneurs Network" (TiE) zugreifen, das jedem Neuankömmling raschen und leichten Zugang zu Experten, Mentoren und Investoren bietet. Aus seiner Keimzelle ist ein globales Netzwerk mit 13.000 Mitgliedern in 18 Ländern geworden. "TiE ist eine wunderbare Einrichtung und ein maßgeblicher Katalysator, um Unternehmer zu ermutigen", sagt der indische Entrepreneur Shreesha Ramdas, der 1998 von Bangalore nach Silicon Valley zog.
Wir stellen vier Lebens- und Karrierewege von Menschen mit indischem und chinesischem Hintergrund vor, die zwischen San Francisco und San Jose eine neue Heimat gefunden haben und aktiv zur anhaltenden Innovationskraft dieser Region beitragen.
Chetana Bisarya, ehemals Weltbank-Consultant, und Nirav Bisarya, Gründer des Start-ups "SaaSrite"
"Ich bin wohl eine seltene Ausnahme, weil ich als Tochter indischer Eltern in Stuttgart geboren und deutsch aufgewachsen bin", sagt Chetana Bisarya über ihren Lebensweg, der sie 2012 nach San Francisco führte. Ihr Vater wagte 1966 den Sprung ins unbekannte Baden-Württemberg, um als junger Ingenieur aus Bangalore und eingefleischter Autofan ein Praktikum bei Porsche zu machen. Daraus wurde eine fast vier Jahrzehnte währende Karriere bei Mercedes-Benz. Auch Bisaryas Mutter, die in Indien ihren Master of Business Administration gemacht hatte, arbeitete fast 20 Jahre bei Mercedes.
Nach dem Abitur zog Bisarya zum Studium erst nach North Carolina und dann nach Washington. "Meine Eltern hatten meiner Schwester und mir eingeschärft, wie wichtig es ist, eine Ausbildung auf Englisch zu absolvieren, denn es eröffnet eindeutig mehr Chancen." In den USA lernte sie ihren Mann Nirav kennen, der als Sohn indischer Einwanderer in Kansas City aufgewachsen war. Seine Eltern waren 1967 als Studenten unabhängig voneinander in Kansas gelandet und hatten sich an der Universität gefunden, anstatt dem traditionellen Pfad einer arrangierten Ehe zu folgen.
"Meine Eltern legten den Grundstein für die indische Community in der Stadt. Gemeinsam mit drei anderen Familien finanzierten und bauten sie den ersten Hindu-Tempel in Kansas City", erinnert sich der 41-jährige IT-Unternehmer. So besuchte er fast jedes Wochenende eine Veranstaltung, um die Kultur der fernen Heimat zu feiern, Spenden für den Tempel einzuwerben oder einfach ausgiebig mit Verwandten und Freunden zu essen.
Vor vier Jahren lockte der Technologie-Boom das Paar nach San Francisco. "Mein Vater war schon immer Unternehmer. Er hat eine eigene Firma, die Funk- und Mikrowellen-Hardware für die Luft- und Raumfahrt und die Telekom-Branche herstellt", berichtet Bisarya. Nachdem er erst als Berater und dann mit seinem Bruder sieben Jahre im Familienbetrieb gearbeitet hatte, versucht er nun an der Westküste sein Glück mit Start-ups, die Dienstleistungen in der Cloud anbieten, und hat seit kurzem seine eigene Tech-Firma namens "SaaSrite" gegründet.
Deutschland ist gleichwohl für die Familie eine Art zweite Heimat geblieben. Ihre zwei Söhne besuchen eine bilinguale Grundschule in San Francisco, wachsen zweisprachig auf und verbringen ihre Sommerferien bei den Großeltern in Stuttgart.
"Die bessere Balance von Arbeit und Freizeit macht Deutschland attraktiv."
Nirav Bisarya, Gründer des Start-ups "SaaSrite"
"Berlin und Hamburg stehen ganz oben auf unserer Liste der Städte, in denen man wohnen könnte. Aber sonst gibt es in Deutschland wenige Orte, die uns ähnlich multikulturell und deshalb so weltoffen und dynamisch vorkommen wie San Francisco", gesteht Nirav Bisarya. "Hier gibt es einfach unglaublich viele Menschen, die anders denken als man selber. Das regt an!" Ein Cousin seiner Frau ist allerdings von Bangalore erst nach Hof zum Studium gezogen und wohnt jetzt in München, da ihm der Trubel Berlins zu viel war.
Sumang Liu und Cheng He, Gründer des Start-ups "Mosaic"
Ein Onkel, der in Hongkong arbeitete, setzte dem zwölfjährigen Sumang Liu den Floh ins Ohr, sein Glück im Ausland zu versuchen, als er noch in einer chinesischen Provinzstadt aufwuchs. "Er machte vor, wie man im Ausland ein wunderbares Leben führen konnte. Und der Inbegriff des guten Lebens war nun einmal Amerika." Deswegen bewarb sich Liu 2010 um einen Studienplatz bei mehreren, wie er selber formuliert, „mittelmäßigen“ US-Hochschulen und zog von Wuhan nach Tennessee. "Da ich aus dem Landesinneren Chinas stamme, hatte ich keine Ahnung, in welche Unis ich reingekommen wäre, wenn ich mich nur gezielter beworben hätte. Wahrscheinlich Stanford."
Tennessee war ein Kulturschock, und Liu nahm sich vor, nach dem Informatik-Studium und einem Praktikum am technologischen Laboratorium "Oak Ridge National Lab" wieder nach China zurückzukehren. "Für die Generation vor uns war das Leben in den USA das höchste Ziel. Doch was den Lebensstandard und vor allem das Tempo angeht, Innovationen zum Massenphänomen und einem großen Geschäft zu machen, hat China inzwischen mindestens genauso viel zu bieten."
Sein erster Job bei Apple 2012 stimmte ihn jedoch schnell um, in den USA zu bleiben. Ende 2015 gründete der 30-Jährige mit seinem Landsmann Cheng He eine eigene Firma in San Francisco.
"Wenn man einmal Silicon Valley aus der Nähe gesehen hat, kann man sich dieser Welt schwer entziehen."
Sumang Liu, Mitgründer des Start-ups "Mosaic"
Ihr Start-up "Mosaic" sitzt an der Schnittstelle von zwei boomenden Bereichen: künstliche Intelligenz und sogenannten Chatbots, virtuellen Assistenten, mit denen man sich unterhalten kann. Das Startkapital sammelte Liu bei chinesischen Investoren ein, die in Kalifornien auf der Suche nach neuen Trends sind. Und das Start-up bestand die Feuertaufe, denn Liu schaffte die Aufnahme in das Gründerzentrum "Y Combinator". "Fürs Erste bleibe ich hier", sagt der frisch-gebackene Unternehmer. "Doch wer weiß, wann sich eine Chance bietet, das Unternehmen in China auszubauen."
Ähnlich erging es Cheng He aus der Millionenstadt Stadt Xian. Er wollte es seinen zwei älteren Schwestern gleichtun, von denen eine nach Großbritannien ausgewandert war und die andere eine längere akademische Rundreise von Nordamerika bis Japan unternommen hatte. "Ich gab mir bei der Bewerbung nicht viel Mühe und landete 2008 an der Uni in Buffalo, New York. Im Vergleich zu meiner Heimatstadt ist das tiefste Provinz", sagt der 30-Jährige über seine ersten Amerika-Erfahrungen.
Auch er trug sich mit dem Gedanken, nach dem Magister wieder nach China zurückzukehren. "Das tun acht von zehn chinesischen Studenten. Im Vergleich zu Indern ist Englisch für viele ein Problem." Doch eine Anstellung beim Unternehmen Cisco öffnete He rasch die Augen. "In Buffalo und Chicago unterhielten sich die Leute über Barbecue und das Wetter. Hier dreht sich das Gespräch sogar in der Schlange im Café um Geschäftsideen und das Netz. Man hat das Gefühl, ständig im Mittelpunkt der technischen Innovation zu sein und die Revolution mitzugestalten. Diese Dichte an Talent und Leidenschaft findet man sonst nirgendwo."
He und Liu kam dabei der Anschluss an ein 1.000 Mitglieder starkes Netzwerk chinesischer IT-Arbeiter und -Gründer namens "Shinect" zugute. An dessen Veranstaltungen teilzunehmen, heißt, Gleichgesinnte zu treffen und vielleicht Partner, Mentoren oder Geldgeber für das nächste Start-up zu finden.
"Wir haben den großen Vorteil, dass wir jetzt beide Kulturen kennen und jederzeit wieder nach China zurückgehen können. Diese Fähigkeit ist hoch gefragt."
Cheng He, Mitgründer des Start-ups "Mosaic"
Die westliche Konsumgesellschaft, die noch der Generation seiner Eltern imponierte, kann ihn nicht in den USA halten. Nur die Aussicht, in der unangefochtenen Hochburg des technischen Fortschritts den Durchbruch zu schaffen.
Den kompletten Artikel mit weiteren spannenden Portraits junger Asiaten, die im Silicon Valley ihr Glück fanden, lesen Sie in unserem aktuellen change Magazin.