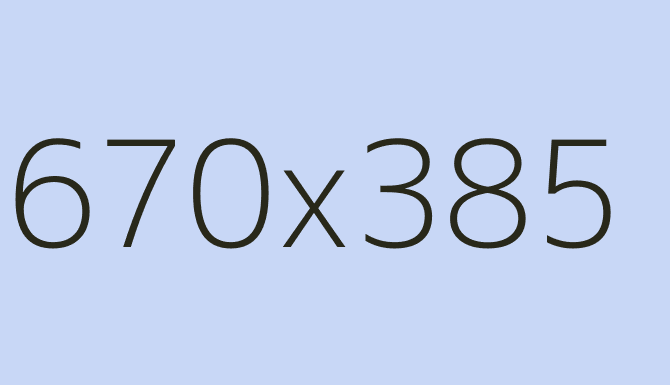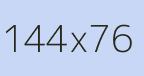Text von Harald Braun für change – das Magazin der Bertelsmann Stiftung. Ausgabe 2/2015 (gekürzte Fassung).

Valeska Achenbach
Gekommen, um zu bleiben
Immer mehr Flüchtlinge aus aller Welt wollen dauerhaft in Deutschland leben. Die Geschichten zweier junger Männer aus Sri Lanka und dem Irak zeigen: Hier liegt auch eine große Chance für die Bundesrepublik – wenn man diese Menschen willkommen heißt und fördert.
Infos zum Text
Kapilraj Muththurasa war 16, als sie kamen, um ihn zu foltern. Er ist Tamile, geboren in Jaffna in Sri Lanka, wo die Auseinandersetzungen zwischen Singhalesen und der tamilischen Minderheit seit 1983 immer wieder aufflackern. Sein Vater hatte 2008 untertauchen müssen, nun wollten die singhalesischen Schergen von Kapilraj wissen, wo er sich aufhielt. Kapilraj sagte nichts, konnte nichts sagen: "Niemand aus meiner Familie wusste, wo mein Vater war, das wäre zu gefährlich für ihn gewesen." Also steckten sie ihn, den sechzehnjährigen Jungen mit dem weichen Gesicht und den sanften Augen, in einen Kerker, in ein dreckiges, schwarzes Loch ohne Tageslicht. Sie holten ihn mehrmals am Tag und in der Nacht und schlugen ihn, immer wieder. Eine Woche lang. Wenn Kapilraj davon erzählt, suchen seine Augen Halt an der Zimmerdecke.
Heute ist Kapilraj Muththurasa 22 Jahre alt und lebt in Deutschland – voller Hoffnung auf ein selbstbestimmtes, ein schönes Leben. Ein Leben, für das er bereit ist, hart zu arbeiten, das beweist er jeden Tag. Momentan ist Kapilraj Auszubildender als Industriemechaniker bei den Grillo-Werken in Duisburg. Ein junger Mann, über den sein Ausbilder Peter Spelleken sagt: "Er beeindruckt uns alle mit seinem Ehrgeiz, mit seinem Arbeitsethos – und mit seiner Persönlichkeit."
Kapilraj Muththurasas Mutter verkaufte sofort ihr Haus, als ihr ältester Sohn nach der Woche im Kerker wieder freigelassen wurde. Ein großes Haus, schon seit Generationen im Besitz der Familie. Von dem Erlös zahlte man 25.000 Euro an einen professionellen Schlepper, damit Kapilraj so schnell wie möglich nach Deutschland ausreisen konnte, in die Freiheit. Wie begründet die Ängste um sein Leben damals waren, zeigt die Frage nach dem Schicksal seiner Eltern. "Sie sind tot." Und seine Geschwister? Kapilraj schaut seinen Ausbilder hilfesuchend an. "Darüber möchte Herr Muththurasa nicht sprechen", übernimmt Peter Spelleken für ihn. Später wird er in einer ruhigen Minute ergänzen: "Wir wissen auch nicht, was mit seiner Familie geschehen ist. Das ist wohl für ihn ein so emotionales Thema, dass er es völlig verdrängt."

Valeska Achenbach
Kapilraj Muththurasa während der Arbeit in seinem Duisburger Ausbildungsbetrieb. Nebenbei lernt er an der Abendschule für die Fachoberschulreife.
Viel mehr als nur ein Lehrling
Kapilrajs Wecker klingelt um 4 Uhr morgens. Jeden Tag. Um 4.35 Uhr verlässt er seine kleine Wohnung in Mülheim an der Ruhr, fährt mit dem Bus, fährt mit dem Zug, fährt wieder mit dem Bus. Zehn vor fünf steht er in der Regel dann vor seinem Ausbildungsbetrieb in Duisburg. 2013 hat er die Lehrstelle als Industriemechaniker erhalten, vier Stellen gibt es pro Jahr, bei etwa 200 Bewerbern. Ausbildungsleiter Peter Spelleken erinnert sich daran, dass Kapilraj schon bei den Tests hervorragend abgeschnitten hatte, er war gut in Mathe, konnte mit seinen Händen umgehen, hatte eine freundliche, verbindliche Art.
"Sein Wille, etwas aus seinem Leben zu machen, hat uns imponiert."
Peter Spelleken, Ausbilder von Kapilraj Muththurasa
Einfach hat es ihm Deutschland nicht gemacht. Er wurde nach seiner Ankunft in Deutschland in einem Asylantenheim untergebracht, acht Männer in einem Zimmer, 183 Euro Sozialhilfe im Monat und keine Chance, etwas Sinnvolles mit seiner Zeit anzufangen. Sechs Monate kämpfte er um einen Schulplatz, vergeblich, machte Ein-Euro-Jobs, sammelte Papier auf, um überhaupt irgendetwas zu tun. Nach sechs Monaten erhielt er ein Visum, fand mit der Hilfe einer Mitarbeiterin des Mülheimer Sozialdienstes eine Wohnung, musste allerdings von dort jeden Tag zwei Stunden lang zur Schule laufen, weil ihm das Geld für Bahn- und Bustickets fehlte. Er suchte sich einen Job in einer Pizzeria, absolvierte Deutschkurse in der Volkshochschule und schaffte unter diesen Bedingungen trotzdem seinen Realschulabschluss. Und er schickte Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz an alle Betriebe im Ruhrgebiet, die für ihn in Frage kamen, 70 an der Zahl. Etwa bei der Hälfte wurde Kapilraj zum Test eingeladen, am Ende hatte er elf Zusagen. Elf! Kapilraj lächelt ein wenig scheu, aber auch stolz. Bei Grillo hat er dann angefangen, weil von dort die erste Zusage kam. Aber auch, weil ihm der Familienbetrieb gefiel. Er hat alle Chancen, nach seiner dreijährigen Lehrzeit übernommen zu werden.
Die Frage ist nur, ob Kapilraj nach seiner Lehre überhaupt bleiben will. Wenn sein Arbeitstag bei Grillo zu Ende ist, macht er weiter Deutschkurse an der Volkshochschule, engagiert sich als Jugendsprecher für die Auszubildenden bei Grillo, die ihn dazu gewählt haben. Außerdem büffelt er auf der Abendschule für die Fachoberschulreife und spielt am Wochenende Kricket in einer Mannschaft in Bochum. Ach ja, den Nebenjob in der Pizzeria macht er auch noch, wann immer es seine Zeit zulässt. Wie bewältigt ein junger Mensch solch ein Pensum? Peter Spelleken sagt: "Er hat einmal, mehr so im Spaß, bemerkt: 'Ich will Ingenieur werden.' Das ist wohl sein heimlicher Traum." Dann zuckt er leicht mit den Schultern und lächelt. Was so viel heißen soll wie: Na, wenn es einer schafft.
Auch Neshwan Hamid möchte so wenig wie möglich über seine Vergangenheit in der alten Heimat sprechen. Seine Familie war bettelarm, sein Vater krank und ohne Arbeit, seine Perspektiven im Irak gleich null. Er sagt das, als ob es ihm schwerfiele, sich überhaupt nur daran zu erinnern. Szenen aus seiner Kindheit, Anekdoten, Freunde? Neswan schaut irritiert. Was sollte das sein? Am liebsten wäre ihm, wenn man sich damit zufriedengäbe, dass er mit 17 Jahren den Irak verließ. Verlassen musste. Denn die Wahrheit ist ja, dass er keine Wahl hatte: Er lebte im Nordirak in der Nähe von Tel Kassab, seine Familie gehört zu den jesidischen Kurden, die seit dem Ende des Irakkrieges 2003 zur Zielscheibe fundamentalistischer Muslime wurden. Die jesidische Minderheit im Irak muss permanent um ihr Leben fürchten, was dazu führt, dass sie seit Jahren in Massen nach Europa und Amerika flüchtet. So wie Hamid, dessen Familie knapp 10.000 Euro an einen Schlepper zahlte. Der brachte ihn 2010 zuerst in ein Auffanglager in der Türkei, nach ein paar Tagen von dort aus weiter nach Frankfurt: einen siebzehnjährigen Jungen, der kein Wort Deutsch sprach, aber immerhin das Glück hatte, dass er seinen acht Jahre älteren Bruder in Bielefeld anrufen konnte. Mit ihm lebt er auch heute noch dort, zusammen mit dessen Frau und zwei kleinen Kindern. Inzwischen spricht Neshwan Hamid gut Deutsch und hat sich in den wenigen Jahren, die er in Deutschland lebt, eine ordentliche Perspektive aufgebaut.
Haben Sie denn keinen Sohn?
"Er war ziemlich hartnäckig" sagt Hans Wieghorst lachend, der in der Bielefelder Innenstadt einen Friseursalon führt, "das hat mir gefallen." Eines Abends stand er einfach vor Wieghorsts Tür, der gerade dabei war, seinen Salon nach Ladenschluss wieder auf Vordermann zu bringen. Zwei Fragen hatte Neshwan Hamid. Eine lautete: "Kann ich bei Ihnen ein Praktikum machen?" Die zweite: "Haben Sie denn keinen Sohn, der hier durchfegt?" Wieghorst erinnert sich sichtlich vergnügt daran, dass Neshwan damals nicht verstehen konnte, dass Wieghorst zwar tatsächlich einen Sohn hat, der aber gar nicht im Laden seines Vaters arbeitete. "Der Zusammenhalt der Familie ist das Wichtigste für ihn", sagt Hans Wieghorst. Das Verhältnis der beiden zueinander ist sichtlich herzlich, vertrauensvoll und fast freundschaftlich. "Mir hat imponiert, dass er immer wieder hergekommen ist, immer wieder – trotz all der Rückschläge. Er wollte unbedingt!"
Wieghorst war sofort bereit, Neshwan ein Praktikum in seinem Geschäft zu ermöglichen. Das scheiterte allerdings an bürokratischen Hürden. "Offiziell existierte Neshwan gar nicht für die deutschen Behörden", sagt Wieghorst, "er hatte keine Sozialversicherungsnummer und konnte deshalb auch nicht versichert werden, ohne Versicherung aber konnte ich ihn hier nicht arbeiten lassen." Unterdessen wurde er nach seinem Antrag auf Asyl in unterschiedliche so genannte Integrationsklassen gesteckt, mit anderen Flüchtlingen zusammen, die weder Deutsch noch Irakisch sprachen. Eine Farce.
"Ich wollte schnell lernen, aber das war dort nicht möglich", erzählt Neshwan, "wir schlugen einfach nur die Zeit tot." Neshwan nervte die Schulämter so lange mit seinem Wunsch nach einer "richtigen" Ausbildung, bis er schließlich 2013 in der Maria-Stemme-Schule in Bielefeld den Hauptschulabschluss in Angriff nehmen konnte. Ein Jahr später war das geschafft. Deutsch lernt er nebenbei immer noch auf eigene Initiative, und auch auf seinen Traum-Beruf des Friseurs bereitete er sich vor, indem er in der eigenen Wohnung Freunden und Bekannten die Haare schön machte. Dass Neshwan sein Praktikum doch noch machen konnte, ist übrigens Wieghorsts Engagement geschuldet. "Ich habe irgendwann den zuständigen Abteilungsleiter bei der Agentur für Arbeit angerufen, nachdem wir auf Sachbearbeiter-Ebene nicht weitergekommen sind, und habe ihm Neshwans Fall geschildert. Plötzlich ging's dann." "Aber es darf natürlich nicht sein, dass das Schicksal von Jungs wie Neshwan von der Eigeninitiative Einzelner abhängt. Es müsste einfacher sein für diese motivierten jungen Menschen, hier Fuß zu fassen." Inzwischen macht Neshwan ein so genanntes EQJ, eine einjährige Qualifikation für eine richtige Ausbildungsstelle. "Die wird auf die Lehrzeit angerechnet, wenn die Leistungen gut sind", sagt Hans Wieghorst und bestätigt: "Praktisch ist Neshwan top, hier im Laden macht er sich prima, ist auch beliebt bei den Kollegen. Aber durch seine Sprachnachteile hat er manchmal noch mit dem theoretischen Stoff Probleme – deshalb geht er nur in das zweite Lehrjahr, wenn es Sinn für ihn macht. Aber wie ich das sehe, schafft er das." Neshwan schaut ihn an, lächelt fein und zieht die Stirn leicht in Falten, als wolle er sagen: Wo, bitteschön, ist das Problem?