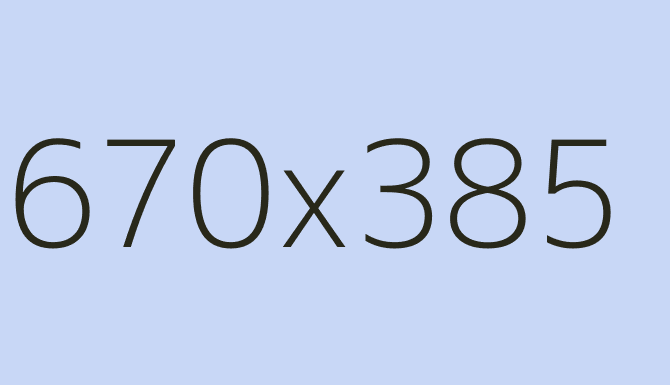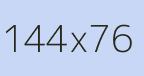Interview geführt von Dagmar Rosenfeld für change – Das Magazin der Bertelsmann Stiftung. Beitrag aus change 4/2014.

Dominik Gigler
Charakter zählt...
… findet Städtetagspräsident Dr. Ulrich Maly, wenn man ihn fragt, was eine Stadt ausmacht. Die Schönheit sei zweitrangig, der Reiz jeder Stadt bestehe in ihrer Unzulänglichkeit. Und natürlich in der Art und Weise, mit den Herausforderungen umzugehen, vor denen jede Kommune steht.
Infos zum Text
Wie steht es um die deutschen Kommunen? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Und wie sollen sie diesen begegnen? – Ein Gespräch mit Dr. Ulrich Maly, dem Präsidenten des Deutschen Städtetags.
change: Geht es um Deutschlands Kommunen, ist oft von einem Zweiklassensystem die Rede – die ohnehin armen Regionen werden immer ärmer, die reichen immer reicher. Wie steht es um unsere Städte und Gemeinden, Herr Maly?
Dr. Ulrich Maly: Tatsächlich geht die Schere zwischen finanziell wohlhabenden und finanziell darbenden Kommunen immer weiter auseinander. Von einem Zweiklassensystem zu sprechen, ist allerdings zu kurz gesprungen. Die Situation unserer Kommunen ist eher mit der unserer Gesellschaft vergleichbar – die Mittelschicht schrumpft, und die Kluft zwischen Arm und Reich wächst.
Liegt das an den Kommunen selbst, also wirtschaften manche einfach besser und schaffen attraktivere Standortbedingungen als andere?
So einfach ist das nicht. In der Regel sind die Kommunen schwächer, die in einem Bundesland liegen, das selbst schwächelt. Länder wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bremen oder das Saarland im Westen sowie die ländlichen Regionen im Osten haben ein hohes Haushaltsdefizit und kämpfen damit, die Schuldenbremse 2020 einhalten zu können. Das heißt, die prekäre Situation vieler Kommunen ist in historischen Strukturschwächen und Strukturwandelprozessen begründet. Kurzum, Stärke kommt aus Stärke und Schwäche aus Schwäche.
"Stärke kommt aus Stärke"
Dr. Ulrich Maly
Eine Kommune kann also nur so gut sein wie das Bundesland, in dem sie liegt?
Ländern, die selbst finanzielle Probleme haben, fehlen die Möglichkeiten, ihre strukturschwachen Regionen zu unterstützen. Diese Regionen haben es schwerer, im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Lebensqualität mitzubieten.
Jede dritte Kommune ist heute nicht mehr in der Lage, ihre Schulden aus eigener Kraft zu tilgen. Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen?
Insgesamt liegen die Kassenkredite, also die ungeplante Verschuldung der deutschen Kommunen, bei 50 Milliarden Euro und die geplante Verschuldung bei 80 Milliarden Euro. Letztere besorgt mich nicht, denn ihr stehen Investitionen gegenüber. Das Problem ist die ungeplante Verschuldung, die entsteht, wenn eine Stadt oder Gemeinde mehr leisten muss, als sie kann.
Offenbar sind viele Kommunen überfordert, denn in den vergangenen zehn Jahren haben sich die Kassenkredite versechsfacht. Welche Möglichkeiten sehen Sie, diesen Trend zu stoppen?
Erstens müssen die Kommunen bei den Sozial-ausgaben entlastet werden, denn eine hohe Kreditbelastung korreliert in den meisten Fällen auch mit hohen Ausgaben für Arbeitslosengeld-empfänger und die Eingliederungshilfe für Behinderte. Damit Sie eine Vorstellung bekommen, um welche Summen es geht: 2013 haben die Städte und Gemeinden 47 Milliarden Euro für soziale Leistungen ausgegeben – das waren 2,5 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Zweitens müssen die Länder den Kommunen Entschuldungsangebote machen. Und drittens brauchen die Städte die Möglichkeit zu investieren. Denn nur auf Kostensenkung zu setzen, macht zwar den kommunalen Haushalt schöner, aber eine Kommune nicht attraktiver. Sie brauchen als Bürgermeister immer ein Stück Gestaltungs-potenzial, um die Menschen bei der Stange beziehungsweise in der Gemeinde zu halten.
Angesichts eines Investitionsrückstands von 118 Milliarden Euro in Deutschlands Kommunen – wie soll es zu schaffen sein, zu investieren und zugleich Schulden abzubauen?
Die einfachste Antwort wäre: mit Geld! Aber ich weiß natürlich, dass Geld nicht beliebig vermehrbar ist, also müssen wir über Verteilungsfragen sprechen. Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist die mit Abstand am schnellsten wachsende Ausgabe – und die hängt allein an den Kommunen. Der Bund zahlt keinen Cent. Das muss sich ändern – und zwar nicht erst 2018!
Ist in dieser Situation die Schuldenbremse mehr Zukunftslast oder Zukunftsvorsorge?
Zukunftslast, weil sich die Bundesländer zum Teil auf dem Rücken der Kommunen entschulden werden, indem sie Zuschüsse, beispielsweise für die Infrastruktur, einstellen. Zukunftsvorsorge, weil die Schuldenbremse uns zwingt, eine vernünftige Diskussion darüber zu führen, wie viel Staat wir wollen und was er uns kosten darf.
Thema „Kosten“ – drei Viertel aller Kommunen planen höhere Steuern und Abgaben. Ist das der richtige Weg?
Nicht zwangsläufig. Die Diskussion sollte sich darauf konzentrieren, was wir mit den Milliardeneinnahmen aus dem Soli machen. Die Mittel werden angesichts der großen anstehenden Aufgaben weiter benötigt, und zwar in ganz Deutschland. Sie könnten insbesondere für Investitionen in die Infrastruktur, für Entschuldung und für Hilfen für strukturschwache Städte eingesetzt werden. Das wäre eine effektive Möglichkeit, die Schuldenbremse einzuhalten und zugleich den Kommunen wieder auf die Beine zu helfen.
Das heißt, uns steht eine Umverteilungsdebatte bevor?
Ja, aber wir dürfen sie nicht ideologisch führen, sondern fokussiert auf die Frage, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Wenn Sie den Menschen sagen, mit einem Teil der Mittel werden marode Brücken saniert, Schlaglöcher ausgebessert und der ÖPNV gestärkt, dann werden Sie mehrheitlich Zustimmung ernten.
Die Kommunen fühlen sich in den großen politischen Fragen oft vom Bund alleingelassen wie jetzt bei der Flüchtlingsfrage. Müssen die Kommunen ausbaden, was auf Bundesebene verschlafen wurde?
Wir wollen ein Land sein, das Asylrecht gewährt. Das ist eine gesamtdeutsche Entscheidung und daher auch eine gesamtstaatliche Aufgabe. Da reicht es nicht, dass der Bund sich um die Asylverfahren und den Bescheid der Asylanträge kümmert und den Rest Ländern und Kommunen überlässt. Wie bei der Jugendarbeitslosigkeit, der Kinderbetreuung und den Ganztagsschulen ist die Flüchtlingsaufnahme ein großes gesellschaftliches Projekt. Aus diesem gemeinsamen Interesse leitet sich auch eine gemeinsame Finanzierungsverpflichtung ab – und zwar für alle staatlichen Ebenen.
Sie wollen, dass der Bund sich an der Unterbringung der Flüchtlinge finanziell beteiligt?
Ja, aber auch viele Länder sind stärker gefordert, und mit Geld allein ist es nicht getan. Wir müssen auch unseren bürokratischen Perfektionismus hinterfragen, das heißt Prozesse und Kommunikationswege vereinfachen. Ein Beispiel: In Ihrer Region gibt es eine leer stehende Kaserne, also schreiben Sie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, dass Sie dort Flüchtlinge unterbringen wollen. Die Bundesimmobilienverwaltung sagt dann, das sei grundsätzlich möglich, aber zuvor müsse beim Verteidigungsministerium angefragt werden, ob die Kaserne nicht doch noch gebraucht werde. Nach Monaten bekommen Sie dann die Antwort, für die Kaserne gebe es womöglich in einigen Jahren noch Verwendung, daher könne sie nicht freigegeben werden. So etwas macht einen vor Ort, wo Sie akut handeln müssen, wahnsinnig. In Situationen wie dem jetzigen Flüchtlings-andrang, müssen wir flexibel reagieren und uns nicht hinter Reglements verstecken.
Sie sehen also kein strukturelles Problem, sondern ein prozessual-kulturelles. Warum wird statt Bürokratie nicht mehr Pragmatismus gewagt?
Ich weiß nicht, warum das Bundesverteidigungsministerium nicht einfach die leer stehenden Kasernen freigibt. Es gibt eine Liste mit mehreren hundert Objekten des Bundes – und dann gibt es einen Brief von der Bundesimmobilienverwaltung. Da steht drin, 30 von diesen Objekten haben wir schon angeboten. Das ist ein Armutszeugnis. Alle Parteien versprechen einen Bürokratieabbau.
Warum ist es so schwer, dieses Versprechen umzusetzen?
Wir sind Opfer unserer arbeitsteiligen Speziali-sierung. Nehmen wir als Beispiel einen emmissionsstarken Betrieb, der sich in einer Stadt niederlassen will. Da prüfen zehn verschiedene Behörden die Ansiedlung. Am Ende hat der Unternehmer dann zig Teilbescheide statt eines Bescheids, der alle Auflagen zusammenführt. Hier ist mehr Kooperation nötig, und die ist in unserer arbeitsteilig organisierten Experten-kultur nichts, was sich automatisch einstellt.
Die Kommunen sind ein Brennglas der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das wird besonders beim demographischen Wandel deutlich, der in vielen Regionen bereits spürbar ist. Sind die Kommunen auf eine alternde Gesellschaft vorbereitet?
Es gibt da keinen standardisierten Masterplan, da sich der demographische Wandel regional völlig unterschiedlich auswirkt. Er bedeutet Wachstum und Schrumpfung zugleich. Wir in Nürnberg etwa haben steigende Geburtenzahlen, und nur 100 Kilometer entfernt verliert ein Landkreis in Nordostoberfranken jedes Jahr 1.000 Einwohner. Die Typologie der demographischen Herausforderungen geht also von Schwarz bis Weiß. Gemeinsam aber ist allen Regionen, ob schrumpfend oder wachsend, dass sie für die Zukunft steigende Kosten fürchten.
Ist diese Sorge berechtigt?
Ich warne davor, die Fortschreibung des Status quo als die wahre Zukunft zu nehmen. Nürnberg zum Beispiel hat heute 500.000 Einwohner, es gab aber auch Zeiten, da waren wir 20.000 mehr, ebenso wie wir schon einmal fast 40.000 weniger waren. Wenn ich während des Schrumpfungsprozesses diese Entwicklung hochgerechnet hätte, wäre ich beim Dorf angekommen, jetzt würde ich bei 600.000 Einwohnern landen. Beides ist falsch. Bei aller Sorge um die finanziellen Herausforderungen des demographischen Wandels sollten wir nicht außer Acht lassen, dass es immer schon Zuzugs- und Abwanderungsbewegungen gegeben hat. Derzeit geht der Trend vom Land in die Stadt, vor 20 Jahren war es genau umgekehrt.
Dennoch ist absehbar, dass die Bevölkerung in manchen Regionen in West und Ost radikal schrumpft. In unseren Köpfen ist das vor allem ein Schreckensszenario – verödete Landstriche, Verfall und zurückgelassene alte Menschen. Kann im Schrumpfen auch eine Chance liegen?
Der Bürgermeister einer ostdeutschen Stadt, die in den vergangenen Jahren 60.000 Einwohner verloren hat, hat zu mir gesagt: „Bei uns sinkt die Arbeitslosenquote jeden Tag, weil die jungen Leute wegziehen“. Hinter diesem bitteren Scherz steht ein Stück Wahrheit, nämlich dass sinkende Einwohnerzahlen nicht Stillstand bedeuten müssen. In Ostdeutschland etwa gibt es landschaftlich wunderschöne Regionen und niedrige Mieten, gerade für ältere Menschen mit nicht allzu üppigen Renten könnte das attraktiv sein. Wo viele Alte sind, gäbe es dann einen Bedarf an Ärzten, Pflegekräften, Haushaltshilfen. Diese Arbeitsplätze wiederum würden jüngere Menschen anlocken.
Ihre Klientel im Deutschen Städtetag sind eher die Regionen, die mit Zuzug umgehen müssen. Ist Wachstum ein Selbstläufer?
Nein, Wachstum erfordert auch eine andere Organisation der Infrastruktur und des öffentlichen Lebens. Wir brauchen in wachsenden Städten jetzt ein Umdenken in der Wohnungspolitik. Die freien Bauflächen sollten nicht einfach an den Höchstbietenden vergeben, sondern der Verkaufspreis an die Quadratmetermiete gebunden werden. Indem Baufläche zu einem günstigeren Preis verkauft wird und der Käufer sich im Gegenzug verpflichtet, einen bestimmten Mietpreis nicht zu übersteigen, kann bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Ebenso wichtig wie der Neubau ist der Wohnungsbestand. Hier müssen wir einen Weg finden, Sozialwohnungen länger in der Belegbindung zu halten, um auch finanziell Schwächeren ein Leben in der Stadt zu ermöglichen.
Das ist der infrastrukturelle Aspekt. Sie sprachen auch von einer veränderten Organisation des öffentlichen Lebens. Was meinen Sie damit?
Der klassische Lebensrhythmus – morgens zur Arbeit, abends nach Hause und am Wochenende frei – trifft nur noch auf eine Minderheit der Bevölkerung zu. Rund zwei Drittel der Einwohner in den Städten sind Rentner, Studierende, Arbeitslose sowie Mütter und Väter, die sich auch der Kindererziehung widmen. Nur, wenn ich heute einem Opernintendanten sage, spiel deine „La Traviata“ nachmittags statt abends, dann erklärt der mir, Nachmittage seien etwas für die Kindervorstellung. Da werden wir umdenken müssen.
"Gestalltungswille der Jüngeren ist gefragt"
Dr. Ulrich Maly
Was die Bevölkerungsstruktur angeht, so ist die Politik ein Spiegel der Gesellschaft. Die Mehrheit der Bürger wird künftig von den Älteren gestellt, schon jetzt ist der Durchschnittswähler über 50 Jahre alt. Hat die junge Generation überhaupt noch eine Chance, in der Politik gehört zu werden?
Da mache ich mir keine Sorgen, vor allem wenn ich mir den politischen Nachwuchs anschaue. In unserer SPD-Fraktion in Nürnberg beispielsweise ist das Durchschnittsalter Mitte 30. Und junge Menschen finden Sie überall in der Kommunalpolitik, in manchen Gemeinden haben Mittzwanziger bereits Bürgermeisterwahlen gewonnen. Das ist doch ein eindeutiges Zeichen, dass auch in einer alternden Gesellschaft der Gestaltungswille der Jüngeren gefragt ist.
Zum Schluss dürfen Sie träumen. Wenn Sie die ideale Kommune gestalten könnten, wie würde die aussehen?
Für mich besteht der Reiz einer Stadt auch in ihrer Unzulänglichkeit. Bildlich gesprochen will ich nicht das Supermodel mit ebenmäßigen Gesichtszügen und perfektem Körper, sondern den Typ Therese Giehse, eine Frau mit Falten, Spuren des Lebens, grauem Haar. Eine Stadt zeichnet sich nicht nur durch Schönheit, sondern sehr stark auch durch Charakter aus.