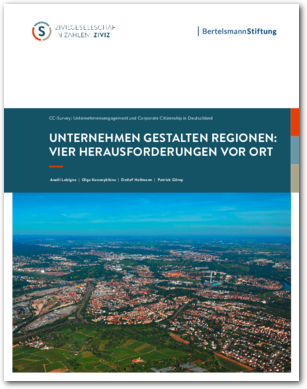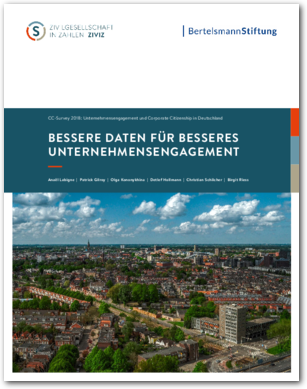Zwischenbilanz 2008 – heute
Zivilgesellschaft in Zahlen: „Wir messen Zivilgesellschaft“
Wir messen Zivilgesellschaft
Die Herausforderungen in der Gesellschaft sind groß. Gutes Aufwachsen für junge Menschen, Hilfen im Notfall, Umweltschutz, Zuwanderung oder internationale Zusammenarbeit – lokale, nationale und globale Entwicklungen können und sollten nicht von der Politik allein gelöst, marktwirtschaftlich geregelt oder privat organisiert werden. Ohne eine funktionierende Zivilgesellschaft und ohne umfassendes bürgerschaftliches Engagement sind die vielfältigen Herausforderungen nicht zu bewältigen. Aber wer oder was ist „die Zivilgesellschaft“ überhaupt?
Obwohl in Deutschland die meisten Lebensbereiche erforscht, analysiert, dokumentiert und gemessen werden, ist es umso erstaunlicher, dass die Wissenschaft der dynamischen Entwicklung der Zivilgesellschaft über viele Jahre hinweg kaum Beachtung geschenkt hat.
Das hat sich inzwischen geändert. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Fritz Thyssen Stiftung und die Bertelsmann Stiftung haben im Jahr 2008 das Projekt „Zivilgesellschaft in Zahlen“ (ZiviZ) gestartet. Das Ziel: Es ging darum, herauszufinden, wie leistungsfähig die Zivilgesellschaft ist.
Deswegen tragen wir seitdem Daten zusammen, vermessen den Sektor, liefern Orientierung und belegen die Relevanz zivilgesellschaftlicher Organisationen als Rückgrat unserer Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit weiteren Partnern entsteht auf diese Weise ein umfassendes „Informationssystem Zivilgesellschaft“, das ständig weiterentwickelt wird.

Wenn in Deutschland von der Zivilgesellschaft geredet wurde, dann war dies für viele Menschen immer ein verschwommener Begriff ohne konkrete Fakten. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir mit unserer gemeinsamen Stiftungs-Initiative der Wissenschaft, den Entscheidern in der Bundesregierung, den Landesregierungen, den Städten und Gemeinden und vor allem den Akteuren in der Zivilgesellschaft selbst eine fundierte Basis liefern, diesen wichtigen Teil unserer Gesellschaft besser zu verstehen.
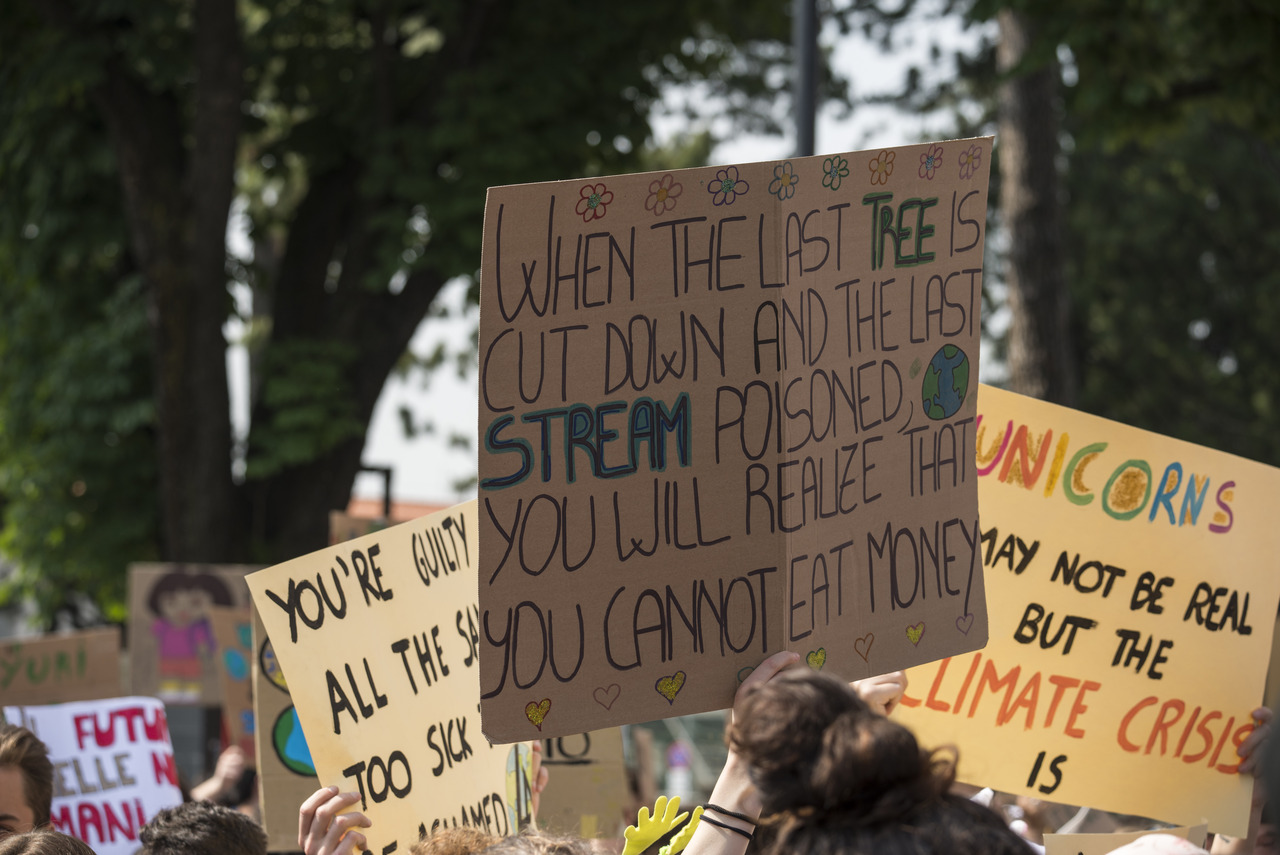
Die Zivilgesellschaft ist unverzichtbar
Kaum ein gesellschaftliches Problem wird heute ohne die Zivilgesellschaft diskutiert. Sie ist unverzichtbar und bildet den Rahmen für bürgerschaftliches Engagement.
Gemeinnützige Einrichtungen (Stiftungen, Genossenschaften, GmbHs) sowie Vereine, Verbände und Initiativen übernehmen selbstorganisiert und freiwillig Aufgaben in einem breiten Tätigkeitsspektrum: Sie informieren über Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschädigungen, helfen Opfern von Naturkatastrophen, organisieren Armenküchen, betreiben Krankenhäuser und Kindergärten oder ermöglichen sportliche Aktivitäten.
Welche Bedeutung und Ausprägung die Zivilgesellschaft mit ihrem rapiden Wachstum in Deutschland wirklich hat, war lange Zeit weitgehend unbekannt. Bei der Aufnahme des Projekts „Zivilgesellschaft in Zahlen“ im Jahr 2008 gab es keine aktuellen Daten über die Rolle, Reichweite, Struktur, Finanzierung und das Beschäftigungsvolumen des gemeinnützigen Sektors. Es fehlten vor allem belastbare Informationen über die Entwicklungstendenzen des Kräftetrios „Staat – Markt – Zivilgesellschaft“.
Partner und Ziele des Programms
Vor diesem Hintergrund vereinbarten der Stifterverband, die Fritz Thyssen Stiftung und die Bertelsmann Stiftung ihre umfassende, langfristig angelegte Zusammenarbeit, um folgende Ziele zu erreichen:
- Erarbeitung einer Datengrundlage für Qualität und Transparenz in der Zivilgesellschaft
- Bereitstellen von Orientierungs- und Trendwissen für Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft
- Verdeutlichung der gesellschaftlichen und politischen Relevanz der Zivilgesellschaft und des bürgerschaftlichen Engagements
Zahlreiche Partner, Förderer und Wegbegleiter haben sich dieser Initiative bis heute angeschlossen, nutzen und multiplizieren die aus dem Datenmaterial analysierten Ergebnisse und Erkenntnisse und verstärken auf diese Weise die Wirkung des Projekts „Zivilgesellschaft in Zahlen“.
„Informationssystem Zivilgesellschaft“: Methodisches Vorgehen – Projektverlauf – Meilensteine
Meilenstein I – Auswertung der Unternehmensregister
Zu den unverzichtbaren Partnern beim Aufbau und der ständigen Weiterentwicklung des „Informationssystems Zivilgesellschaft“ gehört das Statistische Bundesamt. In Zusammenarbeit mit dem Centrum für Soziale Innovationen und Investitionen in Heidelberg wurde in den Jahren zwischen 2008 und 2011 das Unternehmensregister ausgewertet. So war es erstmals möglich, mit Daten der amtlichen Statistik Größe und Struktur der Zivilgesellschaft im Vergleich zum privaten und öffentlichen Sektor zu bestimmen.
Das Ergebnis: Etwa 2,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind in den rund 105.000 Unternehmen tätig, die der Zivilgesellschaft zugeordnet werden können – also nahezu jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland. Auf diesen Bereich entfielen damit etwa 4,1 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung – knapp 90 Milliarden Euro.
Meilenstein II – der erste ZiviZ-Survey 2012
Um die Zivilgesellschaft komplett abzubilden, wurden 2012 mit dem ersten ZiviZ-Survey erstmals Daten und Fakten zur sozialen und politischen Bedeutung der Zivilgesellschaft erhoben.
Dazu wurden über Register und Verzeichnisse alle Vereine, privatrechtlichen Stiftungen, Genossenschaften und gemeinnützigen GmbHs recherchiert und über 610.000 Organisationen in einer Gesamtliste zusammengeführt. Die Befragung anhand einer repräsentativen Stichprobe begann im September 2012 und endete im Januar 2013. Mit den Ergebnissen des ZiviZ-Surveys gab es erstmals repräsentative Daten über die Zivilgesellschaft in Deutschland.

Zu den zentralen Befunden gehörte, dass die Vereine das Rückgrat des zivilgesellschaftlichen Lebens in Deutschland sind: 97 Prozent aller Organisationen des Dritten Sektors gehören zu dieser Kategorie. Deutlich wurde auch, dass sich die Vereinslandschaft verändert: Zwar gehörten zwei Drittel der Vereine den Bereichen Sport, Kultur, Freizeit, Bildung und Erziehung an. Einen Gründungsboom gab es aber vor allem bei den sozialen Diensten und im Bereich des Gesundheitswesens.
Darüber hinaus wurde ermittelt, dass sich nur ein Drittel der zivilgesellschaftlichen Organisationen über öffentliche Gelder finanzieren. Den größten Anteil bekommen Organisationen in den sozialstaatsnahen Bereichen Soziale Dienste, Gesundheit sowie Bildung und Erziehung. Um diese Bereiche nachhaltig finanziell zu unterstützen, empfahlen die Autoren der Studie, dass öffentliche Mittel langfristiger bewilligt und breiter gestreut werden müssten.
Neben dem Hauptbericht sind auf der Datenbasis weitere Berichte entstanden, in denen einzelne Themen vertiefend behandelt wurden:
Meilenstein III – Aufbau einer Geschäftsstelle beim Stifterverband
Um die Arbeit für den weiteren Ausbau des „Informationssystems Zivilgesellschaft“ auf Dauer zu sichern und ständig weiterzuentwickeln, vereinbarten der Stifterverband, die Fritz Thyssen Stiftung und die Bertelsmann Stiftung im Jahr 2014 die Gründung der Geschäftsstelle „ZiviZ im Stifterverband“ mit Sitz in Berlin. Die Federführung liegt somit beim Stifterverband, mit dem die Bertelsmann Stiftung bis heute eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet.
Mit ihren groß angelegten Befragungsprojekten, Förderinitiativen, Expertisen, Policy Papers und Sonderauswertungen trägt die Geschäftsstelle nachhaltig zur Verbesserung der Datenlage und ihrer Praxisprojekte bei. So macht sie die Themen Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches und digitales Engagement gesellschaftlich bekannter und politisch relevanter.
Meilenstein IV – der zweite ZiviZ-Survey 2017
2017 wurde der zweite ZiviZ-Survey veröffentlicht. An der Erhebung haben sich mehr als 6.300 gemeinnützige Organisationen beteiligt. Erstmals wurden in die Befragung auch inhaltliche Schwerpunkte aufgenommen. Es gab gesonderte Fragen zum Engagement im Bildungsbereich, zu den Fördervereinen sowie zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und von Flüchtlingen. Der ZiviZ-Survey 2017 wurde von der Bertelsmann Stiftung, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Robert Bosch Stiftung und der Stiftung Mercator gefördert.

Der zentrale Befund: Allen Thesen über das Vereinssterben zum Trotz – die Zivilgesellschaft in Deutschland wächst. Fast jeder zweite Bundesbürger ist Mitglied in einem von mehr als 600.000 Vereinen in Deutschland. 95 Prozent der gemeinnützigen Organisationen sind Vereine, aber auch Stiftungen und Genossenschaften und andere Organisationsformen nehmen zu.
Zivilgesellschaft verändert sich. Städtische Zivilgesellschaften werden politischer, der ländliche Bereich stärker auf Integration orientiert. Ist das traditionelle Vereinswesen – wie Sport-, Freizeit- und Geselligkeitsvereine – auf dem Land fest verankert, sind in den Städten auch Stiftungen und gemeinnützige Kapitalgesellschaften zu finden. Hier spielen dienstleistungsorientierte oder politisch und sozial ausgerichtete Organisationen eine viel stärkere Rolle.
Jeder fünfte Verein ist ein Förderverein. Knapp 30 Prozent der heute mehr als 130.000 Fördervereine wurde erst nach dem Jahr 2006 gegründet. Damit ist der Förderverein eines der am stärksten wachsenden Segmente unter gemeinnützigen Organisationen. Fördervereine gibt es besonders häufig im Bildungs- und Erziehungsbereich sowie im Kulturbereich.
Vereine, Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen verstehen sich als Teil einer autonomen Zivilgesellschaft. Zwei von Drei (64 Prozent) gemeinnützigen Organisationen halten es für richtig und wichtig, dass ihre Arbeit nicht vom Staat, sondern von der Gesellschaft geleistet und finanziert wird. Ein knappes Drittel (31 Prozent) meint, ihre Arbeit solle zumindest durch den Staat finanziert werden. Nur 6 Prozent verstehen sich als Ausfallbürge und meinen, ihre eigene Arbeit solle von staatlichen Stellen geleistet werden.
Neben dem Hauptbericht sind auf der Datenbasis weitere Berichte entstanden, in denen einzelne Themen vertiefend behandelt wurden:
Weitere vertiefende Auswertungen sind in Arbeit, zum Beispiel zwei Länderauswertungen Bayern und Sachsen sowie eine Auswertung zu den Aktivitäten der Organisationen in der Flüchtlingshilfe.
Meilenstein V – Monitor Unternehmensengagement
Der Monitor Unternehmensengagement ist eine von ZiviZ im Stifterverband und der Bertelsmann Stiftung angeführte Gemeinschaftsinitiative, die belastbare, repräsentative Daten zu Unternehmensengagement beziehungsweise Corporate Citizenship liefert. Ziel der auf Wiederholung angelegten Unternehmensbefragung ist es, das Engagement der deutschen Wirtschaft in der Breite zu erheben und abzubilden.
Die Ergebnisse zeigen, dass es die meisten Unternehmen in Deutschland nicht als ausreichend erachten, Arbeitsplätze zu schaffen und Steuern zu zahlen. Sie wollen sich für die Gesellschaft engagieren. Außerdem geben neun von zehn Führungskräften an, dass Unternehmen stärker auf ihre Vorbildfunktion achten sollten. Knapp zwei von drei Unternehmen lassen diesem Credo konkrete Taten folgen.
Laut Untersuchung liegt die Unternehmensengagement-Quote für Deutschland bei 63 Prozent. Diese engagieren sich über die gesetzlichen Vorschriften hinaus für gesellschaftliche Belange. Dazu gehören primär Geld- und Sachspenden sowie Mitarbeiterfreistellungen und – in deutlich geringerem Maße – auch eigene Engagement-Projekte. Insgesamt gibt die deutsche Wirtschaft 9,5 Milliarden Euro im Jahr für das Gemeinwohl aus. Das ist über eine Milliarde Euro mehr als bisher angenommen und übersteigt sogar die Gesamtsumme der privaten Spenden in Deutschland.
Die Befunde des CC-Survey 2018 zeigen, dass die sogenannten "Corporate Citizens" noch effektiver daran mitarbeiten könnten, gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Das Problem: Ihr Engagement ist selten professionalisiert und wird oft nicht anerkannt.
Um das Potenzial des unternehmerischen Engagements stärker für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu nutzen, müssen unterschiedliche Akteure handeln und Verantwortung übernehmen. Gefragt sind hier zuerst die Unternehmen selbst, aber auch Vertreter der Politik und Zivilgesellschaft.
Unternehmen sollten ihre Ziele auch beim Thema Unternehmensengagement festlegen und definieren, wie diese erreicht werden können. Im Idealfall geschieht das nicht allein, sondern in Netzwerken. Die Bundes- und Landespolitik sollte bürokratische und fiskalische Hürden systematisch überprüfen und gesellschaftliches Engagement durch Steuererleichterungen fördern.
Meilenstein VI – Gründung der ZiviZ gGmbH im Stifterverband
Aus dem Projekt „Zivilgesellschaft in Zahlen“ hat sich nach zehn Jahren Arbeit im Jahr 2018 die ZiviZ gGmbH entwickelt. Sie ist die Datenspezialistin in der Zivilgesellschaftsforschung und versteht sich als Think & Do Tank, der analysiert, berät und vernetzt. Inzwischen arbeitet ZiviZ eng mit NGOs, Stiftungen, Ministerien, Verbänden und Unternehmen zusammen und gibt so neue Impulse für eine starke Zivilgesellschaft.
Aktuelle Daten und Fakten – Ergebnisse des „Datenreports Zivilgesellschaft“
Der „Datenreport Zivilgesellschaft“ (2019) bietet erstmals einen Überblick über Stand und Entwicklung von Zivilgesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement. Ein solcher Zugang ist möglich geworden durch die Zusammenarbeit der Institutionen und Akteure im Forum Zivilgesellschaftsdaten (FZD). Das Forum ist Plattform und Netzwerk aller datenerhebenden Akteure in dem genannten Thema. Es wurde von Mai 2016 bis Juli 2018 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und von ZiviZ im Stifterverband organisiert.
Non-Profit boomt: Der Dritte Sektor – Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbHs und Genossenschaften – ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. „Die organisierte Zivilgesellschaft stellt einen relevanten Faktor im deutschen Arbeitsmarkt dar, der in seiner quantitativen Bedeutung häufig unterschätzt wird“, heißt es im jetzt veröffentlichten „Datenreport Zivilgesellschaft“. Das Buch bietet erstmals einen Überblick aus verschiedenen Datenerhebungen über Stand und Entwicklung von Zivilgesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement in Deutschland – und birgt jede Menge interessantes Zahlenmaterial.
2016 gab es mehr als 600.000 eingetragene Vereine in Deutschland, und mit aktuell 30.000 Stiftungen hat sich der Stiftungsbestand seit dem Jahr 2000 fast verdreifacht. Auch die Zahl der als gemeinnützig eingestuften GmbHs ist zwischen 2007 und 2016 von rund 16.000 auf 25.000 Einrichtungen deutlich gestiegen.
Engagement steht hoch im Kurs. Laut Freiwilligensurvey (2014) sind rund 44 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren freiwillig engagiert (1999: 34 %). Die meisten Menschen (ca. 16 %) engagieren sich im Bereich Sport und Bewegung. Rund 9 Prozent arbeiten ehrenamtlich im Bereich Schule/Kindergarten, ebenso viele in Kultur und Musik. Im sozialen Bereich sind 8,5 Prozent der Menschen freiwillig engagiert, im kirchlichen oder religiösen Bereich 7,6 Prozent.
Am stärksten vertreten sind übrigens junge Menschen im Alter von 14 bis 19 Jahren – mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe ist ehrenamtlich aktiv, gefolgt von der Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen (knapp 50 %). Danach sinkt die Quote – obwohl sich immerhin noch ein Viertel der Menschen über 75 Jahren freiwillig engagiert.
Neben den größtenteils ehrenamtlich getragenen Organisationen hat sich ein professionell aufgestelltes Segment von Organisationen entwickelt, dessen Bedeutung auch für den Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren rasant zugenommen hat. So werden nach Angaben des IAB-Betriebspanels heute deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Tätigkeit bezahlt (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte) als früher: Ihre Zahl stieg von 2,9 Millionen im Jahr 2007 auf 3,7 Millionen im Jahr 2016. Die Entwicklung übertraf damit das allgemeine Beschäftigungswachstum, und der Dritte Sektor konnte seinen Anteil an der Gesamtbeschäftigung leicht ausbauen.
Der größte Teil der Beschäftigten (61 %) arbeitet im Sozial- und Gesundheitswesen. Im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege ist die Altenhilfe mit 26,5 Prozent (445.000) aller Beschäftigten das größte Arbeitsfeld, an zweiter Stelle steht die Gesundheitshilfe mit 392.000 Beschäftigten (23,3 %). Drittgrößter Bereich ist die Kinder- und Jugendhilfe mit 363.000 Mitarbeitenden (21,6 %), gefolgt von der Behindertenhilfe mit 317.000 Personen (18,9 %) und den weiteren Hilfen mit 61.000 Beschäftigten (3,6 %). Die Familienhilfe und die Hilfen für Personen in besonderen sozialen Situationen sind mit 1,9 bzw. 2,3 Prozent vertreten. Zwischen 2004 und 2012 stiegen die Beschäftigungszahlen bei der Jugendhilfe um 32 Prozent, bei der Behindertenhilfe um rund 30 Prozent und bei der Altenhilfe um 21 Prozent.
Die meisten Organisationen im Non-Profit-Sektor haben nicht viel Geld. So hat rund die Hälfte der Vereine maximal 10.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, ein Teil von ihnen noch viel weniger. Einnahmen in Millionenhöhe haben nur 4,5 Prozent der Organisationen. Besser sieht es bei gemeinnützigen GmbHs aus: 42 Prozent verfügen über Einnahmen im Millionenbereich. Ihre Gelder beziehen die Vereine vor allem aus den Mitgliedsbeiträgen (ca. 40 %). Weitere Einnahmequellen sind erwirtschaftete Mittel, zum Beispiel durch Getränke- und Speisenverkauf bei Veranstaltungen (knapp 20 %) und Spenden (ca. 20 %). Öffentliche Mittel spielen bei Vereinen kaum eine Rolle – anders als bei den gemeinnützigen GmbHs.
Zwar ging die Anzahl der Spender über die Jahre deutlich zurück, es wird aber häufiger gespendet. 2016 lag eine Spende im Schnitt bei 35 Euro – bei durchschnittlich knapp sieben Spenden pro Person und Jahr. Die zahlenmäßig größte Gruppe der Spender ist übrigens die Altersgruppe der über 70-Jährigen: 2016 lag der Anteil der Spender dort bei 57 Prozent. Mit durchschnittlich 290 Euro pro Jahr waren sie auch die spendierfreudigsten.
Zwischenbilanz und Wirkung der Stiftungsinitiative ZiviZ
Nach zehn Jahren Zusammenarbeit: Aus der Gründungsidee ist eine breite, Sektor übergreifende Allianz aus Stiftungen, NGOs, Wissenschaftsorganisationen, Ministerien, Verbänden und Unternehmen gewachsen. Diese Allianz trägt zur ständigen Weiterentwicklung des „Informationssystems Zivilgesellschaft“ bei. Herzstück und Motor der Allianz ist die ZiviZ gGmbH im Stifterverband. Als Think & Do Tank liefert sie mit ihren Partnern datenbasiertes Orientierungs- und Trendwissen für die praktische Arbeit der Zivilgesellschaft. Mit ihren Studien und Analysen leistet sie einen Beitrag, die Themen Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches Engagement und Digitalisierung gesellschaftlich bekannter und politisch relevanter zu machen.
Dazu gehören auch ungewöhnliche Kooperationen – etwa mit dem Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von März bis August 2019 zeigt das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig eine Ausstellung, die sich mit dem Phänomen der deutschen Vereinskultur beschäftigt. Sie zeigt den Verein als Ort von Geselligkeit und Gemeinschaft, Tradition und Heimatverbundenheit, der Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus zusammenführt.
Stimmen zum ZiviZ-Survey
Der ZiviZ-Survey hilft uns, Herausforderungen und Perspektiven des demografischen Wandels zu diskutieren.
Der ZiviZ-Survey ist die längst überfällige Datengrundlage, die den hohen Stellenwert unseres Bildungsengagements zeigt.
Gerade der systematische Vergleich mit anderen schärft den Blick auf die eigene Organisation.
Ohne Wissen und ohne Fakten können wir Zivilgesellschaft nicht verstehen und gemeinsam weiterentwickeln.
Der ZiviZ-Survey kann dazu beitragen, dass Migrantenorganisationen von Politik und Gesellschaft endlich wahrgenommen werden.
Richtig und wichtig, dass berichtet wird, was wir tagtäglich in den Vereinen alles ehrenamtlich leisten.