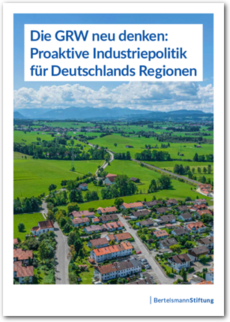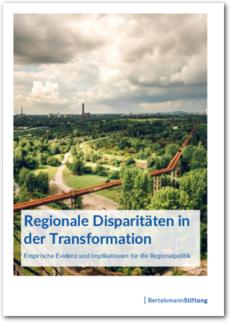Die Dekarbonisierung trifft Deutschlands Regionen unterschiedlich hart. Für eine funktionierende Klima- und Transformationspolitik ist es deshalb essenziell, die „regionale Brille aufzusetzen“. Blendet man regionale Unterschiede bei der politischen Gestaltung der grünen Transformation aus, könnte sich neben der ökonomischen Situation auch die Akzeptanz klimapolitischer Maßnahmen verschlechtern. Proteste oder Protestwählen sind potenzielle Folgen. Erste empirische Befunde aus Deutschland zeigen, dass vor allem rechtspopulistische Parteien mit klimawandelskeptischen Positionen vom ungleich verteilten Transformationsdruck profitieren. Schließlich reagiert deren Unterstützung stark auf Strukturbrüche und wirtschaftliche Schocks.

© ARochau - stock.adobe.com
Proaktive Industriepolitik für Deutschlands Regionen
Vom im Grundgesetz verankerten Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland sicherzustellen, sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Die regionalen Disparitäten – etwa beim Pro-Kopf-Einkommen, der Arbeitslosigkeit oder der öffentlichen Infrastruktur – sind nach wie vor erheblich. Ohne eine umfassende regionalpolitische Begleitung der Transformation hin zur Klimaneutralität drohen sich diese Ungleichheiten weiter zu verschärfen. Schließlich prägen ortsspezifische Faktoren wie z.B. das vorherrschende industrielle Spezialisierungsmuster den Ausgangspunkt wie auch den Verlauf von Transformationsprozessen.
Content
Die grüne Transformation braucht also eine umfassende regionalpolitische Begleitung. Zwar wird im föderalen Deutschland bereits seit Jahrzehnten eine intensive Regionalpolitik betrieben, doch sie trägt bislang häufig den Charakter eines reaktiven Reparaturbetriebs: Sie wird tendenziell in Regionen aktiv, deren ökonomische Kennzahlen weit unterhalb des nationalen Durchschnitts liegen oder die in der Vergangenheit herbe Strukturbrüche zu erleiden hatten. Sie versucht dann, lokale Strukturen zu reparieren und eine weitere Erosion zu verhindern.
Im Zuge der Dekarbonisierung geraten jedoch zunehmend auch jene Regionen unter Druck, die derzeit noch weit überdurchschnittliche Wertschöpfung erzielen. Daher erscheint ein proaktiver Ansatz wesentlich zielführender, wo die regionalpolitische Unterstützung bereits während des Umbruchs erfolgt und sie bei den erforderlichen Investitionen unterstützt. Dies gilt umso mehr, wenn hierdurch auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Dekarbonisierung erhalten werden kann.
Das vorliegende Impulspapier skizziert daher einen Reformvorschlag für eine proaktiv ausgerichtete Regionalpolitik. Im Mittelpunkt steht die mögliche Neuausrichtung des zentralen regionalpolitischen Instruments – der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW).