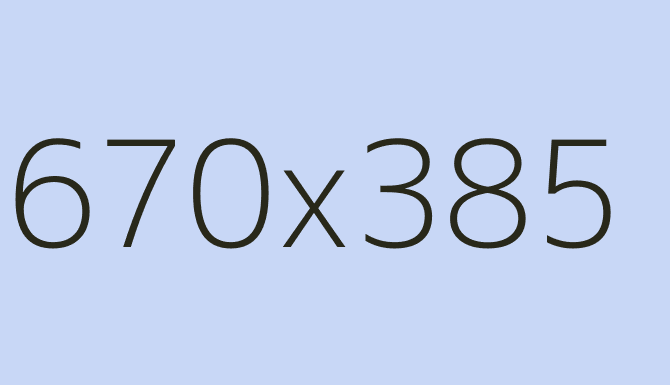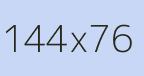Interview von Johannes von Dohnanyi für change – das Magazin der Bertelsmann Stiftung. Ausgabe 1/2016.
"Wir müssen es schaffen!"
Der Ton der Flüchtlingsdebatte wird härter. Angesichts steigender Radikalisierungstendenzen wirbt Kardinal Reinhard Marx eindringlich für die Rückbesinnung auf die Grundwerte christlicher Nächstenliebe.
Infos zum Text
Infos zum Text
Verantwortung tragen – über Grenzen hinaus. Kardinal Reinhard Marx wirbt angesichts der Flüchtlingsdebatte für konstruktive Lösungen, für Herz, Austausch und Offenheit. Wir trafen ihn in München zum Interview.
change: Kardinal Marx, was sagen Sie dazu, dass sich 29 Prozent der Deutschen den Einsatz von Waffen an den Grenzen vorstellen können?
Kardinal Reinhard Marx: Ich rate zu verbaler Abrüstung. Wir sollten uns solche Diskussionen nicht aufzwingen lassen. Das Thema Flucht und Asyl ist hochkomplex und erfordert eine differenzierte Debatte. Wer in unverantwortlicher Weise vereinfacht, macht sich zum Handlanger von Rechtspopulisten.
Die derzeitige Debattenkultur der großen Parteien ist da kein Vorbild.
Gerade jetzt ist wichtig, dass die Regierung fest zusammensteht und Schritt für Schritt an konstruktiven Lösungen arbeitet – auch wenn man ehrlicherweise noch nicht überschauen kann, was in den nächsten Jahren wirklich auf uns zukommen wird.
Gilt Ihr Lob für Frau Merkel und ihren Satz "Wir schaffen das" eigentlich noch uneingeschränkt?
Wir müssen es schaffen. Denn was wäre die Alternative? Aber es geht nicht alleine darum, wie viele Flüchtlinge bei uns im Land sind. Was können wir für Frieden und Wohlstand in den Ländern rund um die Grenzen Europas tun, damit die Menschen dort eine Zukunft haben? Wie können wir beim Aufbau einer politischen Klasse helfen, die Sicherheit schafft? Ich erwarte, dass die Politik den Menschen den Ernst dieser Jahrhundertaufgabe deutlich erklärt, auch dass das eine große finanzielle Herausforderung für uns wird.
Wie passen da Realpolitik und das Gebot christlicher Nächstenliebe noch zusammen?
Die Bischöfe reden nicht einfach so daher, wenn sie auf die großen Traditionen des Christentums verweisen. Wir sind keine realitätsfremden Träumer. Natürlich müssen wir die Realitäten im Blick haben ...
Ich höre schon Ihr "aber" ...
... aber zugleich daran erinnern, dass wir feste Prinzipien brauchen. Die Verantwortung des Politikers endet eben nicht bei seinen Wählern. Eine nachhaltige und verantwortliche Politik muss immer auch die Verantwortung für alle Menschen, also auch die Kranken, Schwachen und Armen, mit einbeziehen, und zwar weltweit. Wir leben doch nicht auf einer Insel. Wir sind miteinander verbunden in einer Verantwortungsgemeinschaft. Nächstenliebe kennt keine nationalen Grenzen und betrifft zum Beispiel auch kommende Generationen.
Sie wissen schon, dass Sie sich jetzt gerade unbeliebt machen?
Warum? Wir haben eine Verantwortung, und aus der kommen wir nicht heraus. Da gibt es sicher auch jeweils verschiedene Bereiche dieser Verantwortung, aber eben auch klare Prinzipien für alle Ebenen. Es muss zum Beispiel klar sein, dass jeder, der europäischen oder deutschen Boden betritt, das Recht auf menschenwürdige Behandlung und ein faires Verfahren hat. An den Grenzen Deutschlands und Europas dürfen keine Menschen umkommen. Dass auch im vergangenen Jahr wieder tausende im Mittelmeer ertrunken sind, ist unerträglich.
Aber Deutschland allein wird die Welt nicht retten können.
Ich erinnere nur an das Gleichnis Jesu vom Barmherzigen Samariter. Ein von Räubern ausgeplünderter Mann liegt schwer verletzt am Straßenrand. Was ist zu tun? Der Priester, der es ja eigentlich besser wissen müsste, geht ebenso vorbei, ohne zu helfen, wie der Levit. Beide fragen sich lediglich: Was wird aus mir? Nur der Samariter, der Ausgegrenzte, fragt: Was wird aus ihm, wenn ich vorübergehe? Das ist die christliche Perspektive. Wir können die Frage nach unserer Verantwortung nicht einfach ausblenden.
Noch einmal: Allein können wir die Welt nicht retten.
Das verlangt doch auch keiner. Und ich hoffe immer noch, dass wir Europäer eine gemeinsame Lösung finden und das Problem gemeinsam schultern werden. Nicht alle Flüchtlinge werden einen berechtigten Asylanspruch in Deutschland haben. Wie viele als Kriegsflüchtlinge bleiben werden, wissen wir noch nicht. Aber wer auf unabsehbar lange Zeit hier leben wird, dem müssen wir helfen, sich zu integrieren.
Welche Regeln müssen für diesen Selektionsprozess gelten?
Das hat damit nichts zu tun, hier geht es um das Menschenrecht auf Asyl. Grundsätzlich muss jeder, der bei uns ist, ein faires Asyl-Verfahren bekommen. Und er darf nicht zurückgeschickt werden in ein Land, in dem ihm Verfolgung, Folter oder gar der Tod drohen. Das ist die rote Linie, bei der es nicht nur um christliche Werte geht. An dieser menschenrechtlichen Perspektive müssen wir festhalten, sonst verlieren wir die Orientierung.
Das allein wird die Zahl der Flüchtlinge kaum reduzieren.
Wir müssen viel dafür tun, damit die Menschen auch als Flüchtlinge im Libanon, in Jordanien und der Türkei menschenwürdig leben können und vor allem natürlich in ihren Heimatländern selbst. Dass sie dort eine Perspektive haben, dass die Kinder zur Schule gehen können. Das wird auch uns viel Geld kosten. Aber die Verantwortungskette hört eben nicht an unserer Grenze auf. Die Geberkonferenz für die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge in London Anfang Februar war ein Schritt in die richtige Richtung.
Und die, die hierbleiben dürfen?
Integration wird nur gelingen, wenn Wohnung, Bildung und Arbeit da sind. Wir müssen begreifen: Je geringer die Chance der jetzt kommenden jungen Leute auf Bildung und Arbeit ist, umso leichter fallen sie in die Hände von Fanatikern oder werden kriminell. Das ist meine Sorge.
Was sagen Sie denen, die Flüchtlinge ganz allgemein als Bedrohung empfinden?
Ängste müssen wir ernst nehmen. Aber viele Untersuchungen zeigen, dass dort, wo Menschen verschiedener Kulturen zusammenleben, die Ausländerfeindlichkeit geringer ist als dort, wo es keine oder nur wenig Kontakte gibt. Begegnung und Austausch sind wichtig, und sie bereichern uns auch. Dagegen neigen scheinbar homogene, geschlossene Gesellschaften dazu, die Grenzen, auch die gedanklichen, dichter zu machen und den anderen als Bedrohung zu sehen.
Überrascht es Sie, dass mit den Flüchtlingen offenbar auch islamistische Terroristen kommen?
Darüber könnte ich nur mutmaßen. Aber auch bei uns in Europa gehen Extremisten unabhängig von den Flüchtlingsströmen auf junge Männer zu, die unzufrieden mit dem bisherigen Leben sind. Denken Sie an die Selbstmordattentäter von Paris. Für einen Christen wäre es übrigens völlig ausgeschlossen, sich und andere umzubringen und sich dabei auf Jesus von Nazareth zu berufen. Das ist völlig unvorstellbar und widerspricht dem ursprünglichen Märtyrergedanken, sein Leben für andere hinzugeben. Ich kenne keine Schrift und keine Tradition, die solches gutheißen würde.
Die islamischen Schriften versprechen den direkten Weg ins Paradies!
Fundamentalistische Fanatiker legen das so aus, die überwiegende Mehrzahl der Muslime folgt diesem Denken nicht. Natürlich gibt es keine absolute Garantie, um Menschen vor solchem Wahnsinn zu schützen. Das beste Gegenmittel ist, dass wir alles versuchen, um diese Menschen durch Arbeit und Bildung voranzubringen.
Pegida und Co. werben für eine andere Lösung: "Deutschland den Deutschen".
Die Zukunft auch unseres Landes liegt im Austausch und in der Offenheit für andere und Neues; damit geschieht auch Weiterentwicklung. Ohne Einwanderung und Neugier auf den Rest der Welt und die Grenzen menschlicher Möglichkeiten gäbe es unser Europa doch gar nicht.
Und mitten in diese ohnehin schon aufgeheizte Debatte platzen dann die Übergriffe von Köln, Hamburg und weiterer Städte ...
Die Silvesternacht in Köln war sicher ein Schock, der die Menschen aufgerüttelt hat. Aber die Antwort kann nur die Durchsetzung des Rechtsstaats und nicht mehr Fremdenhass sein. Auch Köln ändert doch nichts daran, dass wir Menschen unterschiedlicher Kulturen und damit auch unterschiedlicher Weltanschauungen und Religionen auch als Bereicherung und Chance ansehen können und sollten. Denn die Alternative, die Abschottung Europas, wäre keine zukunftsfähige Perspektive.
Befürchten Sie die Islamisierung Deutschlands?
Nein. Dafür bräuchte es eine Strategie, und wer sollte diese betreiben? Der Islam ist keine einheitlich strukturierte Religionsgemeinschaft. Die muslimischen und auch viele christliche Flüchtlinge riskieren die lebensgefährliche Reise, um bei uns in Frieden zu leben. Übrigens fliehen sie oft genau vor den Leuten, denen wir so etwas wie den Versuch einer Islamisierung zuschreiben würden. Nein, auch wenn es sicher Gruppen gibt, die die Not der Menschen ausnutzen wollen – einen globalen Plan zur Islamisierung kann ich nicht erkennen.
Aber der Islam bräuchte schon eine Reformation, um mit unseren Gesellschaften kompatibel zu werden?
Die Islamwissenschaftler und Theologen müssen ihre Religion selber erklären. Ich würde ständige Interpretationen der katholischen Kirche von außen ja auch nicht schätzen. Nur so viel: Auch der Islam hat in seiner Geschichte Reformationen und Renaissancen erlebt. Veränderungen sind aber möglich. Mit Pauschalurteilen kommen wir deshalb nicht weiter.
Vielleicht halten sich die Vorurteile ja, weil es auf wichtige Fragen nur unbefriedigende Antworten gibt?
Die Muslime müssen sich den Ansprüchen der Vernunft und den Fragen unserer offenen, freien Gesellschaft stellen: Wer seid ihr? Wofür steht ihr? Wie begründet ihr das? Wie wollt ihr Gesellschaft aufbauen und Toleranz üben? Was bedeutet das für euch? Diese Fragen, denen wir uns ja auch stellen müssen, kann sich der Islam nicht ersparen.
Viele islamische Gemeinden verweigern sich diesem Diskurs, weil sie den Druck der Extremisten fürchten.
Überall in der globalisierten Welt sind die Vereinfacher auf dem Vormarsch. Aber die Anschlussfähigkeit an den Diskurs der Vernunft und die gemeinsamen Interessen einer Gemeinschaft sind das Mindeste, was eine offene Gesellschaft von einer Religion erwarten muss. Und ich glaube schon, dass die islamischen Gemeinden da noch mehr leisten können.
Und warum tun sie es nicht?
Es fällt dem Islam schwer, sichtbar gemeinsam in einer offenen Gesellschaft aufzutreten, weil er keine kirchliche Struktur oder Ähnliches kennt. Doch wenn die Muslime hier gestalterisch positiv mitwirken wollen, werden sie entsprechende Organisationsformen brauchen. Aber da von außen reinzureden, wäre wohl eher hinderlich.
Wieso sollten wir unsere Ansprüche nicht klar artikulieren?
Bei uns klingt manchmal die Vorstellung von der westlichen Kultur als dem Höhepunkt der Evolution durch, sozusagen wir als das "Ende der Geschichte". Wenn wir so denken, kann es einen Dialog auf Augenhöhe nicht geben. Und dann wird Integration nicht gelingen. Ich halte Demokratie, Marktwirtschaft und Menschenrechte zwar für unverzichtbar. Diese Ideen sind aber im Westen gefunden und entwickelt worden. Gehören tun sie aber allen. Etwas mehr Demut – auch mit Blick auf unsere eigene Geschichte – wäre angemessen.
Der politische Dialog auf Augenhöhe braucht offensichtlich Hilfe von außen. Sehen Sie da die Kirche in der Pflicht?
Wir haben ja immer gesagt, dass die Kirche keine Politik machen, aber dass sie Politik möglich machen soll. Von daher wäre ein vertiefter Dialog der Religionen hilfreich. Nur hat es keinen Sinn, nur schöne Bilder zu produzieren. Es sollte schon etwas dabei herauskommen. Aber da, glaube ich, könnte die katholische Kirche helfen. Übrigens haben die Päpste, aber auch Gemeinschaften wie Sant’Egidio mit ihren Weltfriedenstreffen hier schon viel geleistet.
Und das auf allen Ebenen oder wieder nur in den Spitzenetagen der Weltreligionen?
Ich kann mir das auch im regionalen Bereich vorstellen. Wenn wir über Integration reden, müssen wir uns fragen, was wir für das friedliche Miteinander beitragen können. Das ist eine hochpolitische Aufgabe auch für die Kirche in Deutschland.
Sind das jetzt nur Gedankenspiele?
Im Gegenteil. Es gibt sogar intensive Überlegungen. Wir haben in der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz ein Leitbild für Integration auf den Weg gebracht. Aber da wäre es gut, auf der anderen Seite die richtigen Ansprechpartner zu haben.
Bleibt mutig! Ist das Ihr Appell auch an die tausenden ehrenamtlicher Mitarbeiter?
Es macht mich schon traurig, wenn diese Helfer, die häufig zu katholischen und protestantischen Gemeinden gehören, gelegentlich als etwas naive Menschen angesehen werden. Das Gegenteil ist doch der Fall. Hier lebt es noch, das christliche Abendland. Das Wissen, was Christentum wirklich bedeutet, ist immer noch sehr tief verwurzelt. Für mich war es eine großartige Erfahrung, dass die Gemeinden durch den Kontakt mit den anderen an Identität nicht verloren, sondern gewonnen haben. Sie haben gezeigt: Die christlichen Gemeinden sind aus der Grundstruktur unserer Zivilgesellschaft nicht wegzudenken.
Und was ist die Währung dieser Identität?
Für uns steht die Liebe im Zentrum. Jesus sagt so schön: Wer hat, dem wird gegeben. Das heißt: Wer liebt, wird nicht ärmer, sondern reicher.